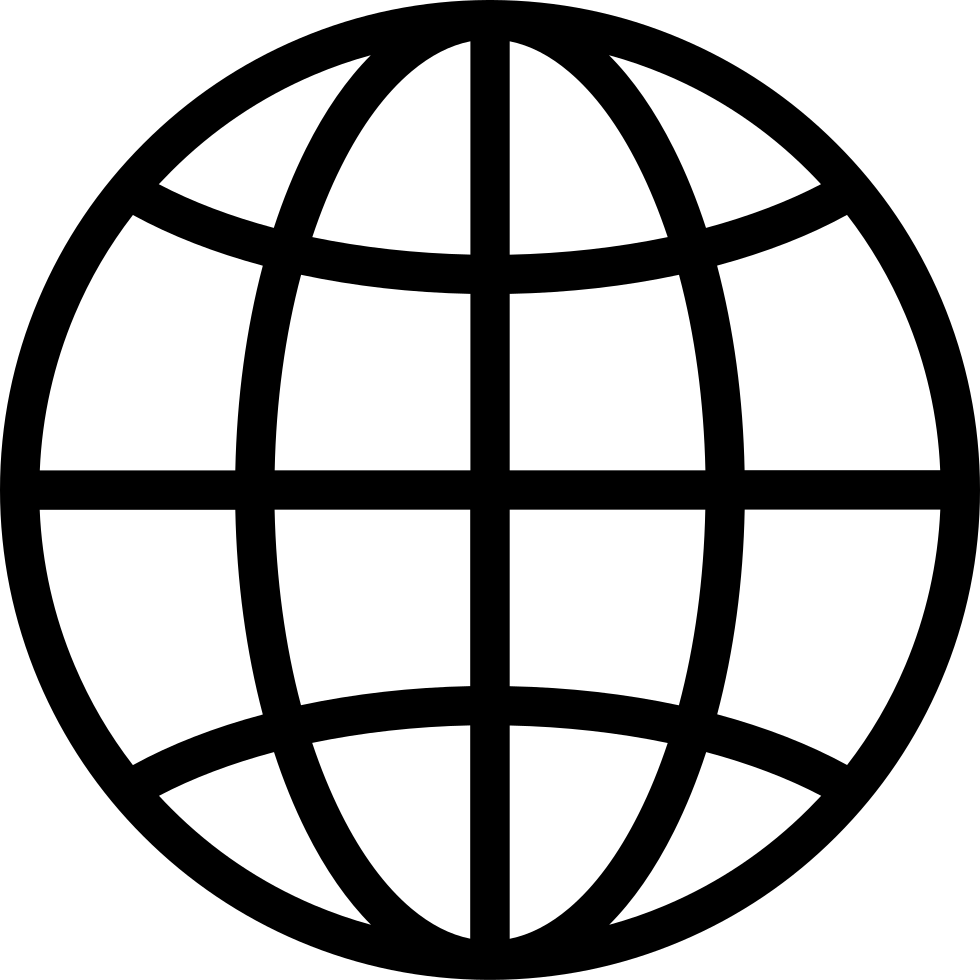Gehen Sie mit der App Player FM offline!
Melancholie in der Philosophie - Zwischen Genialität und Wahnsinn
Manage episode 319930717 series 1833401
Melancholie wird mal als genialisch, mal als krankhaft beschrieben. So auch in zentralen philosophischen Betrachtungen: Von der Antike bis zur Moderne wird der Melancholiker bewundert und verehrt, beklagt und verurteilt. Doch was ist "Melancholie" überhaupt? Ein Blick in die Geistesgeschichte der Melancholie. (BR 2022) Autorin: Susanne Brandl
Credits
Autor/in dieser Folge: Susanne Brandl
Regie: Eva Demmelhuber
Es sprachen: Irina Wanka, René Dumont
Technik: Regina Staerke
Redaktion: Bernhard Kastner
Im Interview:
Mariela Sartorius (Autorin und Fotografin);
Andreas Bähr (Professor Dr.; Kulturwissenschaftler);
László F. Földényi (Autor und Essayist)
Diese hörenswerten Folgen von radioWissen könnten Sie auch interessieren:
Literaturtipps:
Mariela Sartorius: Die hohe Kunst der Melancholie: Die Autorin holt die Melancholie aus ihrer dunklen Ecke. Auf der Suche nach einem positiven.
Lászlo Földényi: Melancholie: Matthes & Seitz, Berlin. Streifzug durch die Kultur- und Philosophiegeschichte der Melancholie. Ausführliche Studie.
Peter Sillem: Melancholie oder vom Glück, unglücklich zu sein. Dtv. Die wesentlichsten Schriften zum Thema Melancholie, Theophrast, Ficino, Kierkegaard uvm.
Wir freuen uns über Feedback und Anregungen zur Sendung per Mail an radiowissen@br.de.
RadioWissen finden Sie auch in der ARD Audiothek:
ARD Audiothek | RadioWissen
JETZT ENTDECKEN
Das vollständige Manuskript gibt es HIER.
Lesen Sie einen Ausschnitt aus dem Manuskript:
ZITATOR SHAKESPEARE: „Wir sind aus solchem Stoff wie Träume sind und unser kleines Leben ist von einem Schlaf umringt.“
01 O-TON Sartorius:
„Oh ja, ja, sehr schön, genau auf den Punkt gebracht. Shakespeare … Bob Dylan mit seinen Texten, Handke, ganz wunderbar.“
SPRECHERIN:
Die Münchner Autorin und Fotografin Mariela Sartorius kennt Melancholie aus eigenem Erleben. Sie hat ein Buch über diese Stimmung verfasst, mit der Absicht, die Melancholie aus ihrer düsteren Ecke zu holen.
02 O-TON Sartorius:
„Mir ist es immer ganz wichtig, den Unterschied zur Depression rauszustellen. Melancholie ist ein Genuss, keine Krankheit, man sollte sie sich gönnen, ab und zu. Und ich finde, Depression engt ein, und Melancholie macht genau das Gegenteil, sie weitet, zeitlich, räumlich. Es ist so ne Gradwanderung. Man muss darauf achten, nicht in die Depression abzurutschen und auf der anderen Seite nicht in den Kitsch und die Sentimentalität.“
SPRECHERIN:
Man spürt sie oder eben nicht, die Melancholie. Wenn sie kommt, dann weiß der Betroffene, sofern er in sich hineinhört, ziemlich genau: ah ja, da ist sie wieder. So beschreibt Mariela Sartorius die Melancholie. Ihr mit Worten gerecht zu werden oder sprachlich zu definieren ist allerdings äußerst kompliziert. (So schwierig wie es zum Beispiel ist, Musik zu beschreiben.)
SPRECHERIN:
Noch schwieriger wird es, wenn es darum geht, Melancholie wissenschaftlich oder historisch zu erfassen. Denn die heutige Wissenschaft weicht ihr weitestgehend aus und jede Epoche hat ein jeweils anderes Bild von Melancholie.
Seit ca. 2.500 Jahren werden so viele unterschiedliche Kriterien auf den Tisch gelegt, dass die Suche nach einer ganzheitlichen Beschreibung der Melancholie einer Mammutaufgabe gleicht.
Der ungarische Autor Lazlo Földenyi hat es gewagt. In zwei enormen Studien geht er der Melancholie auf den Grund. Sein Ergebnis:
03 O-TON Földenyi:
„Ich würde schon sagen, Melancholie ist wie ein schwarzes Loch. Man kann um die Melancholie herumspazieren, viel schreiben, man kann sich immer wieder annähern. Sie selbst kann man nicht anfassen, sondern nur durchleben.“
SPRECHERIN:
Das Wort Melancholie stammt aus dem Altgriechischen und heißt so viel wie „Schwarze Galle“. Zum ersten Mal findet sie sich bei Homer, der über das finstere Herz von Agamemnon schreibt, das von schwarzer Galle umströmt sei. Der antike Arzt Hippokrates, der etwa 460 Jahre vor Christus lebte, entwickelte das Konzept der Viersäftelehre. Danach ist der Mensch dann gesund, wenn seine vier Säfte, das Blut, der Schleim, die gelbe und die schwarze Galle in Balance seien.
SPRECHERIN:
(Aber was genau hatte es mit schwarzer Galle auf sich? War sie gut oder schlecht?) Bei Aristoteles durfte sich die Melancholie mit positiven Attributen schmücken. Wobei sich nicht Aristoteles selbst darüber geäußert hat, sondern wohl einer seiner wichtigsten Schüler: Theophrast. Aus dessen Feder stammt die Sentenz:
ZITATOR Aristoteles: „Warum erweisen sich alle außergewöhnlichen Männer in Philosophie oder Politik oder Dichtung oder in den Künsten als Melancholiker?“
04 O-TON Földenyi:
„Und das ist eigentlich der Beginn des Melancholie-Bewusstseins. Zuerst wird hier auf Melancholie reflektiert und das ist bis zum heutigen Tag ein sehr berühmter und oft zitierter Satz. So fängt Melancholie in der abendländischen Geschichte an.“ 24s
SPRECHERIN:
Was der Philosoph mit „außergewöhnlich“ meint, wird deutlicher, wenn er bestimmte Melancholiker beim Namen nennt.
05 O-TON Földenyi:
„Das waren einerseits Heroen aus der Mythologie, er nennt Aias, Bellerophontes und Herakles und dann nennt er auch Philosophen wie Empedokles, Platon, Sokrates, ein Politiker: Lysander. Also lauter Figuren, die eine außergewöhnliche Leistung hinter sich hatten. Das ist eine Grenzerfahrung, was die alle geleistet haben und alle haben auch die Grenzen überschritten und deswegen wurden sie melancholisch.“
SPRECHERIN:
Außerdem heißt es bei Theophrast, dass Melancholiker zum Wahnsinn neigen, was in der Antike als eine schöne, göttliche Gabe verstanden wird. Denn wie Wahrsager vermögen sie es, aus der Zeit zu treten, die Zusammenhänge des Seins zu erkennen.
Diese Erkenntnisfähigkeit, das Künstlerische oder auch das Fallen aus der Zeit sind Dinge, die sich bis in das heutige Melancholie-Verständnis hineingehalten haben.
06 O-TON Sartorius:
„Natürlich ist das mit Erkenntnis verbunden. Wenn Sie denn nachdenken und das sollte immer mit der Melancholie verbunden sein: warum hat mich das jetzt so, wie sehe ich es denn jetzt, wie sah ich es gestern das Thema oder die Umstände. Es ist vor allem ein sich bewusst machen des Vergänglichen. Es macht aber nicht traurig, sondern es versöhnt. Und wenn man ne melancholische Phase hat, ist man ja direkt ein bisschen wund an dieser dünnen Haut, die es hereingelassen hat und um kreativ zu sein, muss das, was in mich eingedrungen ist, wieder raus. Und das ist dann ne Basis für kreatives Tun.“
SPRECHERIN:
Für Lazlo Földenyi ist Melancholie verbunden mit dem Gefühl von Unlösbarkeit. (Unlösbare Aufgaben und große Momente, wie sie auch die Heroen der Antike durchlebten, machen melancholisch.)
07 O-TON Földenyi:
„Wir alle erleben Momente, wo wir meinen, diese Situation ist unlösbar und trotzdem etwas sehr Wichtiges geschieht, das kann eine übergroße Freude sein oder eine große Trauer oder verliebt sein oder ein kathartischer Kunstgenuss sein. Und man spürt, hier passiert irgendwas, aber was, das kann ich nicht genau in Worte fassen.“
SPRECHERIN:
(Der Welt für einen Moment abhanden zu kommen), in einer unlösbaren Sphäre zu versinken, die mit der Zeitlichkeit konfrontiert, die Grenzen des eigenen Seins aufzeigt, ist in der Antike noch mit Faszination verbunden.
Ganz anders sehen es die Philosophen und Kirchenväter des Mittelalters. Der durchlässige Zustand, dem Erkenntnis nähersteht als Glaube, kann nur eines sein: Teufelswerk. Melancholisch zu sein bedeutet, Gott in Zweifel zu ziehen.
08 O-TON Földenyi:
„Der Melancholiker sehnt sich in das Jenseits, aber das ist nicht religiös gemeint, sondern eher das Unbekannte. Und im Mittelalter gibt es das nicht, sondern es muss alles erklärt werden, alles muss in der großen Kette des Seins eingefügt werden, unbekannt kann nichts bleiben, denn da erscheint der Teufel.“ 22s
SPRECHERIN:
Im klösterlichen Mikrokosmos, geprägt von Entsagung, Gebet und Arbeit gilt die der Melancholiker als faul. So jedenfalls sieht es der Theologe und Philosoph Thomas von Aquin:
ZITATOR Thomas von Aquin:
„Bisweilen dringt sie bis zur Vernunft durch, die in die Flucht einstimmt und in den Schauer und in den Abscheu vor dem göttlichen Gut, wobei das Fleisch gegen den Geist die volle Überhand hat.“
10 O-TON Földenyi:
„Thomas von Aquin empfiehlt viele unterschiedliche Heilmittel. Z.B. die Suche nach Freude, viel weinen, da Tränen die seelische Spannung lindern, Schlaf, Bäder, sehr viel Beten.“
SPRECHERIN:
Auch heute noch gilt die Trägheit als eine der sieben Todsünden.
11 O-TON Sartorius:
„Die Melancholie, die emanzipiert sich natürlich ein bisschen gegenüber dem Glauben. Melancholie sieht ja immer auch das Ende und die andere Seite und die Kirche sieht ja kein Ende, es geht ja immer ganz toll weiter, oder sehr heiß in der Hölle.“
SPRECHERIN:
Die Rettung der Melancholie ist die Renaissance, die von Italien ausgeht. Man besinnt sich wieder auf die Werte der Antike und zum ersten Mal steht der Mensch mit all seinen Widersprüchen im Mittelpunkt des Denkens. Damit hat auch die Melancholie wieder eine Daseinsberechtigung.
Einer, der sich intensiv mit dem Melancholie Konzept der Antike befasst, ist der Philosoph Marsilio Ficino, der führende Kopf der Florentiner Akademie. In seinem Werk „Libri de vita triplici“ von 1482 zeichnet er ein dynamisches Melancholie-Bild.
12 O-Ton Földenyi:
„Melancholie ist für ihn schon ein dynamischer Begriff. Also Melancholie ist keine Krankheit, meint er, aber auch nicht der Gesundheit zuzuordnen, sondern eine Art von Zwischenstadium, ein ständiges Gefährdetsein. Er selbst litt an Melancholie. Und mal beklagt er sich - er meint: Ich bin unglücklich, weil ich so melancholisch bin und anderswo schreibt er: Ich bin glücklich, dass ich so melancholisch bin, denn das ist die Vorbedingung für Philosophie und für große Taten.“ 20s
ZITATOR Marsilio Ficino:
„Wegen meiner allzu großen Furchtsamkeit klage ich mein melancholisches Temperament an und das ich nur durch häufiges Lautenspiel ein wenig lindern und versüßen kann. dann will ich dem Aristoteles beistimmen, der gerade sie für eine göttliche Gabe hält.“
SPRECHERIN:
Ficino sucht nach dem Auslöser seiner eigenen melancholischen Auswüchse und wird in der Astrologie fündig. (Er selbst sei ein Kind des Saturn), schreibt er und alle Melancholiker seien im Zeichen des Saturn geboren. Ein für die heutigen Begriffe eigentümlicher Zusammenhang.
13 O-TON Földenyi:
„Das kommt noch aus dem Hellenismus. Da hat man sich sehr viel mit Astrologie beschäftigt. Und da erschien es zum ersten Mal: Der Saturn ist der Planet der Melancholie und alle, die im Zeichen von Saturn geboren sind, sind Melancholiker. Und später in der Renaissance, die Astrologie kommt zu einem neuen Leben und alle beschäftigen sich damit.“ 5s
ZITATOR Ficino:
„Der Saturn trennt den Menschen von den anderen, macht ihn zu göttlicher Einsicht fähig, glückselig, aber auch von äußerem Elend bedrückt. Es scheint, dass mir der Saturn von Anfang an das Siegel der Melancholie aufgedrückt hat.“
SPRECHERIN:
Zwar ist der Einfluss des Saturn nicht zu ignorieren, aber letzten Endes ist die melancholische Persönlichkeit für ihr eigenes Schicksal selbst verantwortlich. Typisch Renaissance also. (Der Melancholiker kann sein Seelenheil selbst herausfordern und beeinflussen.)
14 O-TON Földenyi:
Und was seine große Neuerung ist: durch entsprechende Betätigung kann jeder Mensch unter den Einfluss des Saturn gelangen, also das heißt: Melancholie ist mit Kreativität verbunden. Und jeder soll danach streben, kreativ und auch melancholisch zu sein.
SPRECHERIN:
Wie aber strebt man danach? Mariela Sartorius meint, um melancholisch zu sein braucht es (eine Begabung), eine hohe Sensibilität. Aber es gibt auch sowas wie Melancholie-Trigger.
15 O-TON Sartorius:
„Bewusste und auch unbewusste. Bei den meisten Melancholikern ist es Musik. Bei mir sind es Texte. Wenn ich irgendwo eine sehr schöne Formulierung lese, dann stellen sich mir die Haare auf vor Genuss. Man kann sie sich nicht reinziehen, wie: ach heute Nachmittag mal bisschen Melancholie. Man muss die Fähigkeit zur Nachdenklichkeit haben.“ 10s
SPRECHERIN:
Geradezu zelebriert wird Melancholie im Zeitalter des Barock, vor allem von denjenigen, die in Prunk und Fülle leben. Melancholie ist weniger ein zu analysierendes Phänomen als ein Gefühl des Morbiden. Sich sehnsüchtig und auch etwas selbstmitleidig in tiefe Abgründe gleiten zu lassen, das ist in der adeligen Gesellschaft damals en vogue.
16 O-TON Sartorius:
„Am Hof des Ludwig des 14., des 15. und vielleicht auch des 16. Ludwig, ja da malten sich die Höflinge Tränen auf die Wangen, damit es so aussieht als hätten sie geweint vor lauter Sensibilität und Melancholie, oh mein Gott! Da war es ein bisschen Usus und auch Mode“. 3s
17 O-TON Bähr
„sie war eben auch ein Zustand, der die Dichtung inspiriert und der die Nähe zum Göttlichen herstellen und auch Ausdruck von Gelehrsamkeit sein konnte.“
So Andreas Bähr von der Europa Universität in Frankfurt.
SPRECHERIN:
Von den dunklen Gemälden des Barock schauen Totenköpfe und verwelkte Blumen, Vanitas und Memento-Mori-Motivik zieht sich durch die Lyrik. Der schlesische Dichter Andreas Gryphius um 1640:
ZITATOR Gryphius:
„Mir ist, ich weiß nicht wie, ich seufze für und für.
Ich weine Tag und Nacht; ich sitz′ in tausend Schmerzen;
Und tausend fürcht′ ich noch; die Kraft in meinem Herzen
Verschwindt, der Geist verschmacht′, die Hände sinken mir.“
SPRECHERIN:
Gut 100 Jahre später wird wieder von außen draufgeblickt: Immanuel Kant schreibt in seinen Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen: Der Melancholiker:
ZITATOR Kant:
„hat vorzüglich ein Gefühl für das Erhabene. Selbst die Schönheit, für welche er ebenso Empfindung hat, muss ihn, indem sie ihm Bewunderung einflößt, rühren. Der Mensch von melancholischer Gemütsverfassung bekümmert sich wenig darum, was andere urteilen, was sie für gut oder für wahr halten, er stützt sich deshalb bloß auf seine eigene Einsicht. Er sieht den Wechsel der Moden mit Gleichgültigkeit und ihren Schimmer mit Verachtung an. Er erduldet keine verworfene Untertänigkeit und atmet Freiheit in einem edlen Busen. (Alle Ketten, von den vergoldeten an bis zu dem schweren Eisen der Galeerensklaven sind ihm abscheulich.)“
SPRECHERIN:
Aber Kant ändert seine Einstellung zur Melancholie 30 Jahre später im grundlegend. Im Licht der Aufklärung wird die Melancholie zum Gravitationszentrum vieler moralphilosophischer Debatten. Das Melancholische als lichtscheue, unberechenbare Größe, die nicht nur im Gegensatz zur Vernunft steht, sondern auch mittels Verstand schwer begriffen werden kann, gilt es zu bezwingen und zu verurteilen. Kants Haltung zur Melancholie wird ambivalent:
18 O-TON Bähr:
„Dieser melancholische Charakter kann sozusagen ausarten. Und dann kommen Zustände dabei heraus, Schwermut, Schwärmerei, in Rachbegierde und dann kann eine melancholische Person durchaus furchterregend werden und kann negative Züge bekommen. Und dann wird Melancholie mit Phantasterei in Verbindung gebracht. Da haben wir eine Melancholie, die umkippen kann in einen pathologischen Zustand.“
SPRECHERIN:
Genauer gesagt: (in trübsinnige Selbstquälerei.) In einen Wahn von Elend, der zur Gemütskrankheit führen kann. Allerdings ist diese Art von Melancholie zu überwinden:
19 O-TON Bähr:
„Durch eine Form von Selbstkontrolle, die letztlich über die Vernunft geleistet werden muss. Gleichzeitig ist sich Kant darüber bewusst, dass der Mensch nunmal nicht nur ein Vernunftwesen ist, sondern auch ein körperliches Wesen, ein empfindendes Wesen und dass diesen Versuchen vor dem Hintergrund auch Grenzen gesetzt sind.“
SPRECHERIN:
Die Dialektik von Geist und Körper, von Licht und Schatten lässt sich nicht auflösen: Während die Vertreter der Aufklärung die Melancholie als grundlose und krankhafte Traurigkeit denunzieren, gibt es auch immer mehr Anhänger der Empfindsamkeit, die im melancholischen Befinden ein höher inspiriertes Leben sehen. (Die Haltung gegenüber der Melancholie wird zur Gretchenfrage.)
Die Melancholie ???? K ist (mit den Anfängen psychologischer Betrachtungen) während der Aufklärung in den Bereich der Krankheit verbannt. Damit ist sie gebrandmarkt. Als geschriebenes Wort taucht sie immer seltener auf. Aber als Empfindung bahnt sie sich im Reich der Künste ihren Weg.
SPRECHERIN:
In Malerei und Musik schwingt sie immer mit, als Nebelmeer oder Mondnacht. Die Melancholie als Membran, die das Jenseits durchscheinen lässt.
20 O-TON Földenyi:
„Der französische Dichter Charles Baudelaire schrieb einmal über irritierende Melancholie und er meinte, die entströmt der Dichtung und der Musik, denn sie zeigt uns eine Welt jenseits des Grabes. Aber er meint, dieses Jenseits des Grabes, das erscheint noch hier im Diesseits. (Musik und Dichtung ist für ihn eine Jenseitserfahrung, aber noch in diesem Leben.) Aber das hat nichts mit Glaube oder mit der Religion zu tun.“
SPRECHERIN:
Dieses melancholische Erleben suchen die Romantiker auch häufig in der Natur.
ATMO (Vogelgezwitscher)
Ein Ort, in dem sich die Melancholie gut finden lässt, so die Autorin und Fotografin Mariela Sartorius:
21 O-TON Sartorius:
„Wenn ich allein so durch die Wälder stromere, da beginnt tatsächlich ein Gefühl, als ob ich verwandt wäre mit dieser Natur, mit nem Grashalm, mit nem Baum, mit ner Wolke, mit nem Lichteinfall und das macht mich ungeheuer durchlässig und da entstehen phantastische Gefühle, die immer mit Melancholie verbunden sind. Denn natürlich weiß man: der Baum stirbt langsam ab, was nicht traurig ist, es ist ein normaler, guter Rhythmus in der Natur.“
SPRECHERIN:
Die Melancholie als Wissen um das Ende.
Diese Ausrichtung auf die Zukunft, ist besonders für einen Melancholiker die Haupt-Quelle seines Leidens. Es ist der Philosoph Sören Kierkegaard.
ZITATOR Kierkegaard:
„Was ist meine Krankheit? Schwermut. Wo hat diese Krankheit ihren Sitz? In der Einbildungskraft; und ihre Nahrung ist die Möglichkeit.“
SPRECHERIN:
Das Einbilden, also das Hoffen auf eine noch nicht eingetretene Zukunft oder das Versinken in eine vergangene Zeit, ist für Kierkegaards Melancholie-Verständnis zentral. Der Melancholiker empfindet eine Art Gegenwartsverlust.
22 O-TON Bähr:
„Das, was beschrieben wird, ist eine Befindlichkeit der Abwesenheit, wenn man so will. Also die Gegenwart wird als unerfüllt wahrgenommen. Daraus resultiert eine doppelte Fluchtbewegung. In die Vergangenheit und eine Hoffnung auf zukünftige Zustände. Das spezifisch Melancholische daran, ist dass diese Fluchtbewegung keinen Erfolg hat, weil das Vergangene selbst im Grunde ein Zustand des Unerfülltseins ist und das Künftige ein Zustand der Unerfüllbarkeit.“
(SPRECHERIN:
Der Mensch, meint Kierkegaard, sei:
ZITATOR Kierkegaard:
„das unglücklichste und melancholischste Tier“.)
SPRECHERIN:
Wer sich als unglücklich beschreibt, beschreibt die anderen als glücklich, die es aber nur deswegen sind, weil sie bestimmte leidbringende Dimensionen nicht erkennen. Hier ist die Melancholie wieder mit Erkenntnis verbunden. Gar nicht so schlimm also? Kierkegaard schreibt jedenfalls auch:
ZITATOR Kierkegaard:
„Doch was sage ich: „der Unglücklichste“? „Der Glücklichste“ sollte ich sagen.“
23 O-TON Bähr:
„Hier spitzt Kierkegaard das im Grunde dahingehend zu, dass man nur im Zustand von Unglücklichsein wahrhaft glücklich sein kann. Also kann man sich fragen, wie weit will Kierkegaard hinaus aus diesem Zustand…jedenfalls stellt er es am Ende so dar, also dass im Grunde in diesem Zustand des Unglücklichseins das eigentliche Glück liegt.
SPRECHERIN:
Melancholie in Zusammenhang mit Glück zu denken, scheint allerdings im Zuge der Moderne immer abwegiger. Im Laufe des 19./20. Jahrhunderts entwickelt sich eine Pathologisierung der Melancholie, die dann im 20. Jhdt. in die Prägung des Begriffs der Depression mündet. Bis heute wird Melancholie oft in die dunkle Ecke gestellt. Der Duden erklärt Melancholie zu einem:
ZITATOR Duden:
„von großer Niedergeschlagenheit, Traurigkeit oder Depressivität gekennzeichneten Gemütszustand.“
SPRECHERIN:
Nach all seinen Untersuchungen hat Lazlo Földenyi doch noch einen gemeinsamen Nenner aller Melancholie-Begriffe gefunden. Es ist die Offenheit für das Unbekannte.
24 O-TON Földenyi:
„Was ich feststellte, egal in welchem Zeitalter, die Melancholie war immer eine Art von Verlust des Weltvertrauens, und man wollte immer wieder über die Horizonte gehen, alltägliche Horizonte, Richtung etwas Unbekannten. Das Unbekannte im Bekannten zu erkennen und das irgendwie wahrzunehmen.
SPRECHERIN:
Als Melancholiker erfährt man also immer wieder den Moment des Scheiterns angesichts unlösbarer Phänomene wie den Verlust, die Vergänglichkeit, den Tod, das Leben nach dem Tod. Schwierig, in der heutigen Wissensgesellschaft, die zudem einem gewissen Machbarkeitswahn nicht abgeneigt ist:
25 O-TON Földenyi:
„Unsere ganze jetzige Welt scheint uns zu überzeugen, dass alles irgendwie gemacht werden kann. Und die Melancholie mahnt uns: Es gibt sehr viele unlösbare Dinge, angefangen von unserem Tod bis zu den unterschiedlichsten Erfahrungen im Leben. fehlt nicht Also die, die melancholisch sind, sind nicht unbedingt schwermütig oder traurig, es kann auch mit Glückseligkeit verbunden sein. Aber Melacnholie ist eine Offenheit für Fragen, die anachronistisch klingen.“ 14s
SPRECHERIN:
Mariela Sartorius ist überzeugt davon, dass mehr Melancholie gesellschaftlich von Vorteil wäre. Sie glaubt an ihre kraftspendende Wirkung des Innehaltens, des zu sich selbst Kommens.
26 O-TON Sartorius:
„Dieser Fitnesswahn, diese Selbstoptimierung, dieses Effizientsein auf Teufel komm raus, ja - da bleibt jetzt nicht viel Zeit für Melancholie. Und wenn sie dann kommt, muss sie ja ganz schnell in ihre Schranken gewiesen werden, denn dann könnte man ja nicht die Karriere machen, die man machen möchte. Oder das Geld verdienen, das man dringend braucht. Deswegen hat die Melancholie schon was Luxuriöses an sich.“
SPRECHERIN:
Die kritischsten Philosophen fanden etwas Gutes in ihr. Künstler, Dichter und Denker haben sie beschworen, ihr gehuldigt, sie verewigt. Vielleicht gerade deswegen, weil sie sich nicht definieren lässt. Eines aber ist sie ganz bestimmt: zutiefst menschlich. Und wäre sie eine Person, sie ließe sich so beschreiben:
27 O-TON Sartorius:
„Die Melancholie ist weiblich. Nun, gut, das Wort: DIE Melancholie. Hieße es DER Melancholie, wer weiß. Aber hmm, ich weiß nicht...also sie ist wohl weiblich. Sie ist schwer greifbar, ist eigensinnig, kommt und geht wann sie will und wenn sie ein unter Anführungszeichen „Opfer“ gefunden hat, dann ist sie gleich da. Und dann muss man ihr sagen: Ich bin gar kein Opfer, komm nur her, liebe Melancholie.“
STOPP
4276 Episoden
Manage episode 319930717 series 1833401
Melancholie wird mal als genialisch, mal als krankhaft beschrieben. So auch in zentralen philosophischen Betrachtungen: Von der Antike bis zur Moderne wird der Melancholiker bewundert und verehrt, beklagt und verurteilt. Doch was ist "Melancholie" überhaupt? Ein Blick in die Geistesgeschichte der Melancholie. (BR 2022) Autorin: Susanne Brandl
Credits
Autor/in dieser Folge: Susanne Brandl
Regie: Eva Demmelhuber
Es sprachen: Irina Wanka, René Dumont
Technik: Regina Staerke
Redaktion: Bernhard Kastner
Im Interview:
Mariela Sartorius (Autorin und Fotografin);
Andreas Bähr (Professor Dr.; Kulturwissenschaftler);
László F. Földényi (Autor und Essayist)
Diese hörenswerten Folgen von radioWissen könnten Sie auch interessieren:
Literaturtipps:
Mariela Sartorius: Die hohe Kunst der Melancholie: Die Autorin holt die Melancholie aus ihrer dunklen Ecke. Auf der Suche nach einem positiven.
Lászlo Földényi: Melancholie: Matthes & Seitz, Berlin. Streifzug durch die Kultur- und Philosophiegeschichte der Melancholie. Ausführliche Studie.
Peter Sillem: Melancholie oder vom Glück, unglücklich zu sein. Dtv. Die wesentlichsten Schriften zum Thema Melancholie, Theophrast, Ficino, Kierkegaard uvm.
Wir freuen uns über Feedback und Anregungen zur Sendung per Mail an radiowissen@br.de.
RadioWissen finden Sie auch in der ARD Audiothek:
ARD Audiothek | RadioWissen
JETZT ENTDECKEN
Das vollständige Manuskript gibt es HIER.
Lesen Sie einen Ausschnitt aus dem Manuskript:
ZITATOR SHAKESPEARE: „Wir sind aus solchem Stoff wie Träume sind und unser kleines Leben ist von einem Schlaf umringt.“
01 O-TON Sartorius:
„Oh ja, ja, sehr schön, genau auf den Punkt gebracht. Shakespeare … Bob Dylan mit seinen Texten, Handke, ganz wunderbar.“
SPRECHERIN:
Die Münchner Autorin und Fotografin Mariela Sartorius kennt Melancholie aus eigenem Erleben. Sie hat ein Buch über diese Stimmung verfasst, mit der Absicht, die Melancholie aus ihrer düsteren Ecke zu holen.
02 O-TON Sartorius:
„Mir ist es immer ganz wichtig, den Unterschied zur Depression rauszustellen. Melancholie ist ein Genuss, keine Krankheit, man sollte sie sich gönnen, ab und zu. Und ich finde, Depression engt ein, und Melancholie macht genau das Gegenteil, sie weitet, zeitlich, räumlich. Es ist so ne Gradwanderung. Man muss darauf achten, nicht in die Depression abzurutschen und auf der anderen Seite nicht in den Kitsch und die Sentimentalität.“
SPRECHERIN:
Man spürt sie oder eben nicht, die Melancholie. Wenn sie kommt, dann weiß der Betroffene, sofern er in sich hineinhört, ziemlich genau: ah ja, da ist sie wieder. So beschreibt Mariela Sartorius die Melancholie. Ihr mit Worten gerecht zu werden oder sprachlich zu definieren ist allerdings äußerst kompliziert. (So schwierig wie es zum Beispiel ist, Musik zu beschreiben.)
SPRECHERIN:
Noch schwieriger wird es, wenn es darum geht, Melancholie wissenschaftlich oder historisch zu erfassen. Denn die heutige Wissenschaft weicht ihr weitestgehend aus und jede Epoche hat ein jeweils anderes Bild von Melancholie.
Seit ca. 2.500 Jahren werden so viele unterschiedliche Kriterien auf den Tisch gelegt, dass die Suche nach einer ganzheitlichen Beschreibung der Melancholie einer Mammutaufgabe gleicht.
Der ungarische Autor Lazlo Földenyi hat es gewagt. In zwei enormen Studien geht er der Melancholie auf den Grund. Sein Ergebnis:
03 O-TON Földenyi:
„Ich würde schon sagen, Melancholie ist wie ein schwarzes Loch. Man kann um die Melancholie herumspazieren, viel schreiben, man kann sich immer wieder annähern. Sie selbst kann man nicht anfassen, sondern nur durchleben.“
SPRECHERIN:
Das Wort Melancholie stammt aus dem Altgriechischen und heißt so viel wie „Schwarze Galle“. Zum ersten Mal findet sie sich bei Homer, der über das finstere Herz von Agamemnon schreibt, das von schwarzer Galle umströmt sei. Der antike Arzt Hippokrates, der etwa 460 Jahre vor Christus lebte, entwickelte das Konzept der Viersäftelehre. Danach ist der Mensch dann gesund, wenn seine vier Säfte, das Blut, der Schleim, die gelbe und die schwarze Galle in Balance seien.
SPRECHERIN:
(Aber was genau hatte es mit schwarzer Galle auf sich? War sie gut oder schlecht?) Bei Aristoteles durfte sich die Melancholie mit positiven Attributen schmücken. Wobei sich nicht Aristoteles selbst darüber geäußert hat, sondern wohl einer seiner wichtigsten Schüler: Theophrast. Aus dessen Feder stammt die Sentenz:
ZITATOR Aristoteles: „Warum erweisen sich alle außergewöhnlichen Männer in Philosophie oder Politik oder Dichtung oder in den Künsten als Melancholiker?“
04 O-TON Földenyi:
„Und das ist eigentlich der Beginn des Melancholie-Bewusstseins. Zuerst wird hier auf Melancholie reflektiert und das ist bis zum heutigen Tag ein sehr berühmter und oft zitierter Satz. So fängt Melancholie in der abendländischen Geschichte an.“ 24s
SPRECHERIN:
Was der Philosoph mit „außergewöhnlich“ meint, wird deutlicher, wenn er bestimmte Melancholiker beim Namen nennt.
05 O-TON Földenyi:
„Das waren einerseits Heroen aus der Mythologie, er nennt Aias, Bellerophontes und Herakles und dann nennt er auch Philosophen wie Empedokles, Platon, Sokrates, ein Politiker: Lysander. Also lauter Figuren, die eine außergewöhnliche Leistung hinter sich hatten. Das ist eine Grenzerfahrung, was die alle geleistet haben und alle haben auch die Grenzen überschritten und deswegen wurden sie melancholisch.“
SPRECHERIN:
Außerdem heißt es bei Theophrast, dass Melancholiker zum Wahnsinn neigen, was in der Antike als eine schöne, göttliche Gabe verstanden wird. Denn wie Wahrsager vermögen sie es, aus der Zeit zu treten, die Zusammenhänge des Seins zu erkennen.
Diese Erkenntnisfähigkeit, das Künstlerische oder auch das Fallen aus der Zeit sind Dinge, die sich bis in das heutige Melancholie-Verständnis hineingehalten haben.
06 O-TON Sartorius:
„Natürlich ist das mit Erkenntnis verbunden. Wenn Sie denn nachdenken und das sollte immer mit der Melancholie verbunden sein: warum hat mich das jetzt so, wie sehe ich es denn jetzt, wie sah ich es gestern das Thema oder die Umstände. Es ist vor allem ein sich bewusst machen des Vergänglichen. Es macht aber nicht traurig, sondern es versöhnt. Und wenn man ne melancholische Phase hat, ist man ja direkt ein bisschen wund an dieser dünnen Haut, die es hereingelassen hat und um kreativ zu sein, muss das, was in mich eingedrungen ist, wieder raus. Und das ist dann ne Basis für kreatives Tun.“
SPRECHERIN:
Für Lazlo Földenyi ist Melancholie verbunden mit dem Gefühl von Unlösbarkeit. (Unlösbare Aufgaben und große Momente, wie sie auch die Heroen der Antike durchlebten, machen melancholisch.)
07 O-TON Földenyi:
„Wir alle erleben Momente, wo wir meinen, diese Situation ist unlösbar und trotzdem etwas sehr Wichtiges geschieht, das kann eine übergroße Freude sein oder eine große Trauer oder verliebt sein oder ein kathartischer Kunstgenuss sein. Und man spürt, hier passiert irgendwas, aber was, das kann ich nicht genau in Worte fassen.“
SPRECHERIN:
(Der Welt für einen Moment abhanden zu kommen), in einer unlösbaren Sphäre zu versinken, die mit der Zeitlichkeit konfrontiert, die Grenzen des eigenen Seins aufzeigt, ist in der Antike noch mit Faszination verbunden.
Ganz anders sehen es die Philosophen und Kirchenväter des Mittelalters. Der durchlässige Zustand, dem Erkenntnis nähersteht als Glaube, kann nur eines sein: Teufelswerk. Melancholisch zu sein bedeutet, Gott in Zweifel zu ziehen.
08 O-TON Földenyi:
„Der Melancholiker sehnt sich in das Jenseits, aber das ist nicht religiös gemeint, sondern eher das Unbekannte. Und im Mittelalter gibt es das nicht, sondern es muss alles erklärt werden, alles muss in der großen Kette des Seins eingefügt werden, unbekannt kann nichts bleiben, denn da erscheint der Teufel.“ 22s
SPRECHERIN:
Im klösterlichen Mikrokosmos, geprägt von Entsagung, Gebet und Arbeit gilt die der Melancholiker als faul. So jedenfalls sieht es der Theologe und Philosoph Thomas von Aquin:
ZITATOR Thomas von Aquin:
„Bisweilen dringt sie bis zur Vernunft durch, die in die Flucht einstimmt und in den Schauer und in den Abscheu vor dem göttlichen Gut, wobei das Fleisch gegen den Geist die volle Überhand hat.“
10 O-TON Földenyi:
„Thomas von Aquin empfiehlt viele unterschiedliche Heilmittel. Z.B. die Suche nach Freude, viel weinen, da Tränen die seelische Spannung lindern, Schlaf, Bäder, sehr viel Beten.“
SPRECHERIN:
Auch heute noch gilt die Trägheit als eine der sieben Todsünden.
11 O-TON Sartorius:
„Die Melancholie, die emanzipiert sich natürlich ein bisschen gegenüber dem Glauben. Melancholie sieht ja immer auch das Ende und die andere Seite und die Kirche sieht ja kein Ende, es geht ja immer ganz toll weiter, oder sehr heiß in der Hölle.“
SPRECHERIN:
Die Rettung der Melancholie ist die Renaissance, die von Italien ausgeht. Man besinnt sich wieder auf die Werte der Antike und zum ersten Mal steht der Mensch mit all seinen Widersprüchen im Mittelpunkt des Denkens. Damit hat auch die Melancholie wieder eine Daseinsberechtigung.
Einer, der sich intensiv mit dem Melancholie Konzept der Antike befasst, ist der Philosoph Marsilio Ficino, der führende Kopf der Florentiner Akademie. In seinem Werk „Libri de vita triplici“ von 1482 zeichnet er ein dynamisches Melancholie-Bild.
12 O-Ton Földenyi:
„Melancholie ist für ihn schon ein dynamischer Begriff. Also Melancholie ist keine Krankheit, meint er, aber auch nicht der Gesundheit zuzuordnen, sondern eine Art von Zwischenstadium, ein ständiges Gefährdetsein. Er selbst litt an Melancholie. Und mal beklagt er sich - er meint: Ich bin unglücklich, weil ich so melancholisch bin und anderswo schreibt er: Ich bin glücklich, dass ich so melancholisch bin, denn das ist die Vorbedingung für Philosophie und für große Taten.“ 20s
ZITATOR Marsilio Ficino:
„Wegen meiner allzu großen Furchtsamkeit klage ich mein melancholisches Temperament an und das ich nur durch häufiges Lautenspiel ein wenig lindern und versüßen kann. dann will ich dem Aristoteles beistimmen, der gerade sie für eine göttliche Gabe hält.“
SPRECHERIN:
Ficino sucht nach dem Auslöser seiner eigenen melancholischen Auswüchse und wird in der Astrologie fündig. (Er selbst sei ein Kind des Saturn), schreibt er und alle Melancholiker seien im Zeichen des Saturn geboren. Ein für die heutigen Begriffe eigentümlicher Zusammenhang.
13 O-TON Földenyi:
„Das kommt noch aus dem Hellenismus. Da hat man sich sehr viel mit Astrologie beschäftigt. Und da erschien es zum ersten Mal: Der Saturn ist der Planet der Melancholie und alle, die im Zeichen von Saturn geboren sind, sind Melancholiker. Und später in der Renaissance, die Astrologie kommt zu einem neuen Leben und alle beschäftigen sich damit.“ 5s
ZITATOR Ficino:
„Der Saturn trennt den Menschen von den anderen, macht ihn zu göttlicher Einsicht fähig, glückselig, aber auch von äußerem Elend bedrückt. Es scheint, dass mir der Saturn von Anfang an das Siegel der Melancholie aufgedrückt hat.“
SPRECHERIN:
Zwar ist der Einfluss des Saturn nicht zu ignorieren, aber letzten Endes ist die melancholische Persönlichkeit für ihr eigenes Schicksal selbst verantwortlich. Typisch Renaissance also. (Der Melancholiker kann sein Seelenheil selbst herausfordern und beeinflussen.)
14 O-TON Földenyi:
Und was seine große Neuerung ist: durch entsprechende Betätigung kann jeder Mensch unter den Einfluss des Saturn gelangen, also das heißt: Melancholie ist mit Kreativität verbunden. Und jeder soll danach streben, kreativ und auch melancholisch zu sein.
SPRECHERIN:
Wie aber strebt man danach? Mariela Sartorius meint, um melancholisch zu sein braucht es (eine Begabung), eine hohe Sensibilität. Aber es gibt auch sowas wie Melancholie-Trigger.
15 O-TON Sartorius:
„Bewusste und auch unbewusste. Bei den meisten Melancholikern ist es Musik. Bei mir sind es Texte. Wenn ich irgendwo eine sehr schöne Formulierung lese, dann stellen sich mir die Haare auf vor Genuss. Man kann sie sich nicht reinziehen, wie: ach heute Nachmittag mal bisschen Melancholie. Man muss die Fähigkeit zur Nachdenklichkeit haben.“ 10s
SPRECHERIN:
Geradezu zelebriert wird Melancholie im Zeitalter des Barock, vor allem von denjenigen, die in Prunk und Fülle leben. Melancholie ist weniger ein zu analysierendes Phänomen als ein Gefühl des Morbiden. Sich sehnsüchtig und auch etwas selbstmitleidig in tiefe Abgründe gleiten zu lassen, das ist in der adeligen Gesellschaft damals en vogue.
16 O-TON Sartorius:
„Am Hof des Ludwig des 14., des 15. und vielleicht auch des 16. Ludwig, ja da malten sich die Höflinge Tränen auf die Wangen, damit es so aussieht als hätten sie geweint vor lauter Sensibilität und Melancholie, oh mein Gott! Da war es ein bisschen Usus und auch Mode“. 3s
17 O-TON Bähr
„sie war eben auch ein Zustand, der die Dichtung inspiriert und der die Nähe zum Göttlichen herstellen und auch Ausdruck von Gelehrsamkeit sein konnte.“
So Andreas Bähr von der Europa Universität in Frankfurt.
SPRECHERIN:
Von den dunklen Gemälden des Barock schauen Totenköpfe und verwelkte Blumen, Vanitas und Memento-Mori-Motivik zieht sich durch die Lyrik. Der schlesische Dichter Andreas Gryphius um 1640:
ZITATOR Gryphius:
„Mir ist, ich weiß nicht wie, ich seufze für und für.
Ich weine Tag und Nacht; ich sitz′ in tausend Schmerzen;
Und tausend fürcht′ ich noch; die Kraft in meinem Herzen
Verschwindt, der Geist verschmacht′, die Hände sinken mir.“
SPRECHERIN:
Gut 100 Jahre später wird wieder von außen draufgeblickt: Immanuel Kant schreibt in seinen Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen: Der Melancholiker:
ZITATOR Kant:
„hat vorzüglich ein Gefühl für das Erhabene. Selbst die Schönheit, für welche er ebenso Empfindung hat, muss ihn, indem sie ihm Bewunderung einflößt, rühren. Der Mensch von melancholischer Gemütsverfassung bekümmert sich wenig darum, was andere urteilen, was sie für gut oder für wahr halten, er stützt sich deshalb bloß auf seine eigene Einsicht. Er sieht den Wechsel der Moden mit Gleichgültigkeit und ihren Schimmer mit Verachtung an. Er erduldet keine verworfene Untertänigkeit und atmet Freiheit in einem edlen Busen. (Alle Ketten, von den vergoldeten an bis zu dem schweren Eisen der Galeerensklaven sind ihm abscheulich.)“
SPRECHERIN:
Aber Kant ändert seine Einstellung zur Melancholie 30 Jahre später im grundlegend. Im Licht der Aufklärung wird die Melancholie zum Gravitationszentrum vieler moralphilosophischer Debatten. Das Melancholische als lichtscheue, unberechenbare Größe, die nicht nur im Gegensatz zur Vernunft steht, sondern auch mittels Verstand schwer begriffen werden kann, gilt es zu bezwingen und zu verurteilen. Kants Haltung zur Melancholie wird ambivalent:
18 O-TON Bähr:
„Dieser melancholische Charakter kann sozusagen ausarten. Und dann kommen Zustände dabei heraus, Schwermut, Schwärmerei, in Rachbegierde und dann kann eine melancholische Person durchaus furchterregend werden und kann negative Züge bekommen. Und dann wird Melancholie mit Phantasterei in Verbindung gebracht. Da haben wir eine Melancholie, die umkippen kann in einen pathologischen Zustand.“
SPRECHERIN:
Genauer gesagt: (in trübsinnige Selbstquälerei.) In einen Wahn von Elend, der zur Gemütskrankheit führen kann. Allerdings ist diese Art von Melancholie zu überwinden:
19 O-TON Bähr:
„Durch eine Form von Selbstkontrolle, die letztlich über die Vernunft geleistet werden muss. Gleichzeitig ist sich Kant darüber bewusst, dass der Mensch nunmal nicht nur ein Vernunftwesen ist, sondern auch ein körperliches Wesen, ein empfindendes Wesen und dass diesen Versuchen vor dem Hintergrund auch Grenzen gesetzt sind.“
SPRECHERIN:
Die Dialektik von Geist und Körper, von Licht und Schatten lässt sich nicht auflösen: Während die Vertreter der Aufklärung die Melancholie als grundlose und krankhafte Traurigkeit denunzieren, gibt es auch immer mehr Anhänger der Empfindsamkeit, die im melancholischen Befinden ein höher inspiriertes Leben sehen. (Die Haltung gegenüber der Melancholie wird zur Gretchenfrage.)
Die Melancholie ???? K ist (mit den Anfängen psychologischer Betrachtungen) während der Aufklärung in den Bereich der Krankheit verbannt. Damit ist sie gebrandmarkt. Als geschriebenes Wort taucht sie immer seltener auf. Aber als Empfindung bahnt sie sich im Reich der Künste ihren Weg.
SPRECHERIN:
In Malerei und Musik schwingt sie immer mit, als Nebelmeer oder Mondnacht. Die Melancholie als Membran, die das Jenseits durchscheinen lässt.
20 O-TON Földenyi:
„Der französische Dichter Charles Baudelaire schrieb einmal über irritierende Melancholie und er meinte, die entströmt der Dichtung und der Musik, denn sie zeigt uns eine Welt jenseits des Grabes. Aber er meint, dieses Jenseits des Grabes, das erscheint noch hier im Diesseits. (Musik und Dichtung ist für ihn eine Jenseitserfahrung, aber noch in diesem Leben.) Aber das hat nichts mit Glaube oder mit der Religion zu tun.“
SPRECHERIN:
Dieses melancholische Erleben suchen die Romantiker auch häufig in der Natur.
ATMO (Vogelgezwitscher)
Ein Ort, in dem sich die Melancholie gut finden lässt, so die Autorin und Fotografin Mariela Sartorius:
21 O-TON Sartorius:
„Wenn ich allein so durch die Wälder stromere, da beginnt tatsächlich ein Gefühl, als ob ich verwandt wäre mit dieser Natur, mit nem Grashalm, mit nem Baum, mit ner Wolke, mit nem Lichteinfall und das macht mich ungeheuer durchlässig und da entstehen phantastische Gefühle, die immer mit Melancholie verbunden sind. Denn natürlich weiß man: der Baum stirbt langsam ab, was nicht traurig ist, es ist ein normaler, guter Rhythmus in der Natur.“
SPRECHERIN:
Die Melancholie als Wissen um das Ende.
Diese Ausrichtung auf die Zukunft, ist besonders für einen Melancholiker die Haupt-Quelle seines Leidens. Es ist der Philosoph Sören Kierkegaard.
ZITATOR Kierkegaard:
„Was ist meine Krankheit? Schwermut. Wo hat diese Krankheit ihren Sitz? In der Einbildungskraft; und ihre Nahrung ist die Möglichkeit.“
SPRECHERIN:
Das Einbilden, also das Hoffen auf eine noch nicht eingetretene Zukunft oder das Versinken in eine vergangene Zeit, ist für Kierkegaards Melancholie-Verständnis zentral. Der Melancholiker empfindet eine Art Gegenwartsverlust.
22 O-TON Bähr:
„Das, was beschrieben wird, ist eine Befindlichkeit der Abwesenheit, wenn man so will. Also die Gegenwart wird als unerfüllt wahrgenommen. Daraus resultiert eine doppelte Fluchtbewegung. In die Vergangenheit und eine Hoffnung auf zukünftige Zustände. Das spezifisch Melancholische daran, ist dass diese Fluchtbewegung keinen Erfolg hat, weil das Vergangene selbst im Grunde ein Zustand des Unerfülltseins ist und das Künftige ein Zustand der Unerfüllbarkeit.“
(SPRECHERIN:
Der Mensch, meint Kierkegaard, sei:
ZITATOR Kierkegaard:
„das unglücklichste und melancholischste Tier“.)
SPRECHERIN:
Wer sich als unglücklich beschreibt, beschreibt die anderen als glücklich, die es aber nur deswegen sind, weil sie bestimmte leidbringende Dimensionen nicht erkennen. Hier ist die Melancholie wieder mit Erkenntnis verbunden. Gar nicht so schlimm also? Kierkegaard schreibt jedenfalls auch:
ZITATOR Kierkegaard:
„Doch was sage ich: „der Unglücklichste“? „Der Glücklichste“ sollte ich sagen.“
23 O-TON Bähr:
„Hier spitzt Kierkegaard das im Grunde dahingehend zu, dass man nur im Zustand von Unglücklichsein wahrhaft glücklich sein kann. Also kann man sich fragen, wie weit will Kierkegaard hinaus aus diesem Zustand…jedenfalls stellt er es am Ende so dar, also dass im Grunde in diesem Zustand des Unglücklichseins das eigentliche Glück liegt.
SPRECHERIN:
Melancholie in Zusammenhang mit Glück zu denken, scheint allerdings im Zuge der Moderne immer abwegiger. Im Laufe des 19./20. Jahrhunderts entwickelt sich eine Pathologisierung der Melancholie, die dann im 20. Jhdt. in die Prägung des Begriffs der Depression mündet. Bis heute wird Melancholie oft in die dunkle Ecke gestellt. Der Duden erklärt Melancholie zu einem:
ZITATOR Duden:
„von großer Niedergeschlagenheit, Traurigkeit oder Depressivität gekennzeichneten Gemütszustand.“
SPRECHERIN:
Nach all seinen Untersuchungen hat Lazlo Földenyi doch noch einen gemeinsamen Nenner aller Melancholie-Begriffe gefunden. Es ist die Offenheit für das Unbekannte.
24 O-TON Földenyi:
„Was ich feststellte, egal in welchem Zeitalter, die Melancholie war immer eine Art von Verlust des Weltvertrauens, und man wollte immer wieder über die Horizonte gehen, alltägliche Horizonte, Richtung etwas Unbekannten. Das Unbekannte im Bekannten zu erkennen und das irgendwie wahrzunehmen.
SPRECHERIN:
Als Melancholiker erfährt man also immer wieder den Moment des Scheiterns angesichts unlösbarer Phänomene wie den Verlust, die Vergänglichkeit, den Tod, das Leben nach dem Tod. Schwierig, in der heutigen Wissensgesellschaft, die zudem einem gewissen Machbarkeitswahn nicht abgeneigt ist:
25 O-TON Földenyi:
„Unsere ganze jetzige Welt scheint uns zu überzeugen, dass alles irgendwie gemacht werden kann. Und die Melancholie mahnt uns: Es gibt sehr viele unlösbare Dinge, angefangen von unserem Tod bis zu den unterschiedlichsten Erfahrungen im Leben. fehlt nicht Also die, die melancholisch sind, sind nicht unbedingt schwermütig oder traurig, es kann auch mit Glückseligkeit verbunden sein. Aber Melacnholie ist eine Offenheit für Fragen, die anachronistisch klingen.“ 14s
SPRECHERIN:
Mariela Sartorius ist überzeugt davon, dass mehr Melancholie gesellschaftlich von Vorteil wäre. Sie glaubt an ihre kraftspendende Wirkung des Innehaltens, des zu sich selbst Kommens.
26 O-TON Sartorius:
„Dieser Fitnesswahn, diese Selbstoptimierung, dieses Effizientsein auf Teufel komm raus, ja - da bleibt jetzt nicht viel Zeit für Melancholie. Und wenn sie dann kommt, muss sie ja ganz schnell in ihre Schranken gewiesen werden, denn dann könnte man ja nicht die Karriere machen, die man machen möchte. Oder das Geld verdienen, das man dringend braucht. Deswegen hat die Melancholie schon was Luxuriöses an sich.“
SPRECHERIN:
Die kritischsten Philosophen fanden etwas Gutes in ihr. Künstler, Dichter und Denker haben sie beschworen, ihr gehuldigt, sie verewigt. Vielleicht gerade deswegen, weil sie sich nicht definieren lässt. Eines aber ist sie ganz bestimmt: zutiefst menschlich. Und wäre sie eine Person, sie ließe sich so beschreiben:
27 O-TON Sartorius:
„Die Melancholie ist weiblich. Nun, gut, das Wort: DIE Melancholie. Hieße es DER Melancholie, wer weiß. Aber hmm, ich weiß nicht...also sie ist wohl weiblich. Sie ist schwer greifbar, ist eigensinnig, kommt und geht wann sie will und wenn sie ein unter Anführungszeichen „Opfer“ gefunden hat, dann ist sie gleich da. Und dann muss man ihr sagen: Ich bin gar kein Opfer, komm nur her, liebe Melancholie.“
STOPP
4276 Episoden
Alle Folgen
×Willkommen auf Player FM!
Player FM scannt gerade das Web nach Podcasts mit hoher Qualität, die du genießen kannst. Es ist die beste Podcast-App und funktioniert auf Android, iPhone und im Web. Melde dich an, um Abos geräteübergreifend zu synchronisieren.