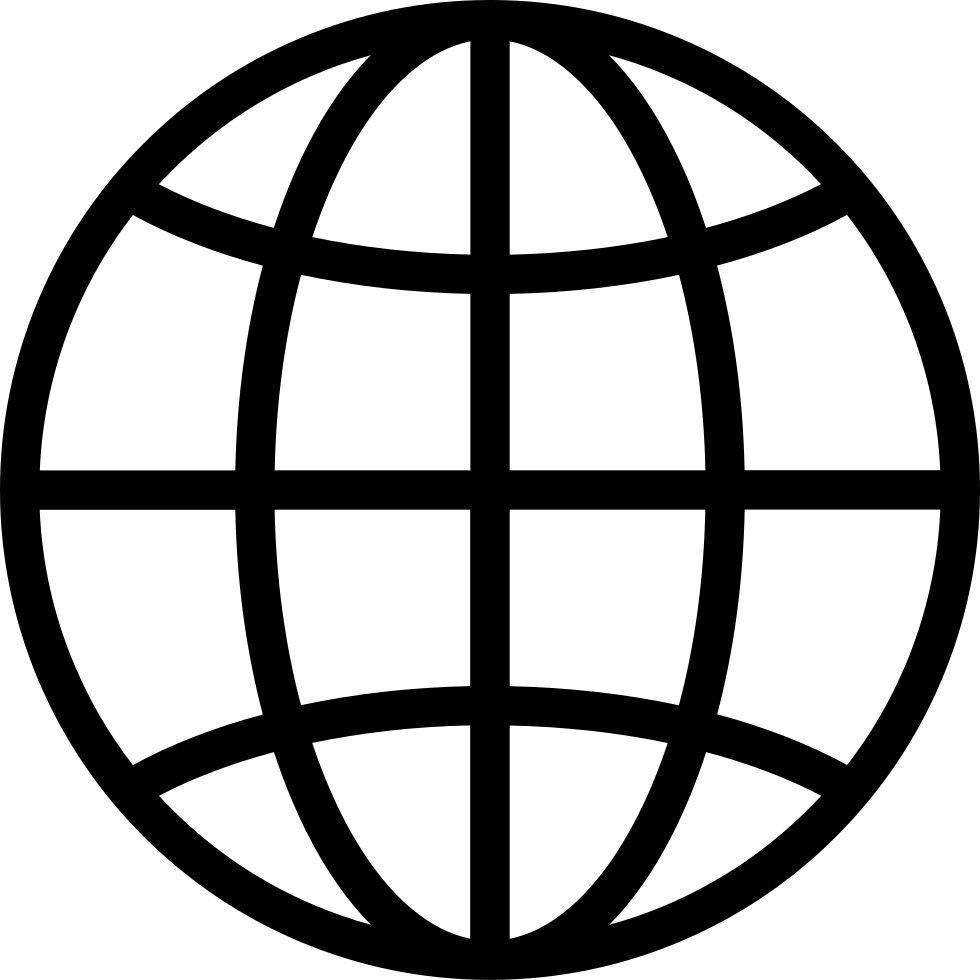Innovationsmanagement mit Sascha Friesike
Archivierte Serien ("Inaktiver Feed" status)
When?
This feed was archived on December 09, 2023 23:09 (
Why? Inaktiver Feed status. Unsere Server waren nicht in der Lage einen gültigen Podcast-Feed für einen längeren Zeitraum zu erhalten.
What now? You might be able to find a more up-to-date version using the search function. This series will no longer be checked for updates. If you believe this to be in error, please check if the publisher's feed link below is valid and contact support to request the feed be restored or if you have any other concerns about this.
Manage episode 291817390 series 2914447
Sascha Friesike ist Professor für Design digitaler Innovation an der Universität der Künste Berlin. Mit ihm spreche ich über Schnellboote und Tanker, Arroganz gegenüber dem Alten und nachhaltige Innovation.
Es gibt sie: die Redaktionen und Medienhäuser, die erkannt haben, dass sie sich in Sachen Innovation bewegen müssen. Die den Weg gehen – dann aber Fehler machen. Um diese Fehler geht es in dieser Ausgabe – und vor allem um die Frage, wie sie sich vermeiden lassen.
Sascha Friesike ist Direktor des Weizenbaum-Instituts für die vernetzte Gesellschaft und beschäftigt sich in seiner Forschung damit, welche Rolle das Digitale spielt, wenn Neues entsteht. Er blickt dabei auch auf das Innovationsmanagement in Organisationen – und auf all die Labs und Hubs und Innovationseinheiten, die zuletzt reihenweise entstanden sind.
Mit Sascha Friesike spreche ich über die typischen Probleme im Innovationsmanagement von Medienhäusern. Wir beschäftigen uns mit der Arroganz und Ignoranz mancher Innovationsmenschen, über die permanente Abwertung von dem, was da ist. Und wir blicken auf die oft überzogenen Erwartungen an Innovation – und die Frage, welcher Maßstab sich besser eignet als das Silicon Valley und das iPhone.
Das Gespräch mit Sascha Friesike in Textform
Dennis Horn: Dieses Gespräch könnte auch mir weh tun. Du hast heute die Rolle, Porzellan zu zerschlagen, weil du dich mit einer deiner Studentinnen, die ihre Masterarbeit zum Thema geschrieben hat, mit Innovation Labs in Unternehmen beschäftigt hast. Vor zwei Jahren habe ich selbst ein solches mitentwickelt und gegründet: den Innovation Hub im WDR. Ich höre also aufmerksam zu. Wie seid ihr zu diesem Thema gekommen?
Sascha Friesike: Ich beschäftige mich mit dem Thema schon ein paar Jahre. Ich habe eine Professur für das Design digitaler Innovation, beschäftige mich eigentlich immer schon damit, wie Neues in die Welt kommt, und bin vor Jahren schon über diese Lab-Einheiten gestolpert. Ich habe dann intensiver angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, weil es mal eine Capgemini-Studie gab, die zum Ergebnis hatte, dass neun von zehn dieser Labs nach einer gewissen Zeit wieder geschlossen werden. Gleichzeitig habe ich einen ehemaligen Kollegen, mit dem ich zusammen promoviert habe – der hat sich aus der Beratung heraus sehr stark damit beschäftigt, solche Labs aufzubauen. Mit dem waren wir mal in der Schweiz wandern, und er hat nur geweint und meinte: „Da wird so viel Unfug gebaut, über den ich schon in dem Augenblick, in dem wir es aufbauen, sagen kann, dass er in drei Jahren wieder zugemacht wird.“ Das fand ich total faszinierend: dass es das so gibt, dass es so viel Aufmerksamkeit bekommt, dass es so oft schief geht. Darüber habe ich einen Vortrag gehalten, und eine Masterandin, die ich zu dieser Zeit betreut habem fand das spannend. Sie ist eigentlich sehr positiv in dieses Thema reingegangen und hat gesagt, wir bräuchten eigentlich mehr dieser Innovation Labs. Da habe ich gesagt, guck dir doch mal ein paar an. Sprich mal mit denen und finde heraus, ob die wirklich alle so zufrieden sind – und ob da wirklich so viel Innovation entsteht. Ich habe dann eine Zeit lang diese Masterarbeit betreut, die einen ganz spannenden Blick darauf gezeichnet und sich angeschaut hat: Kann ich das Selbstverständnis dieser Innovationseinheiten irgendwie theoretisch beschreiben? Und wir sind dann dazu gekommen, mit der Idee eines Paradoxons zu erklären, was da los ist. Ein Paradox ist immer ein gleichzeitiger Anspruch an sich gegenseitig ausschließende Dinge: Ich hätte gern ein großes Auto, das in kleine Parklücken passt. Und dieses Bild hat sie eigentlich ständig gefunden, wenn sie mit diesen Innovations Labs gesprochen hat.
Dennis Horn: Das ist ja recht ähnlich zu der Geschichte dieses Podcasts, die auch damit begonnen hat, dass ich gemerkt habe: Innovation scheitert in Medienhäusern oft an ganz ähnlichen Punkten. Ich würde mit dir gerne einmal eure Erkenntnisse durchgehen. Es waren vier zentrale, und Punkt Nummer eins war: Innovationseinheiten sind zu oft mit sich selbst beschäftigt und dann gar nicht mehr so viel mit Innovation an sich. Warum?
Sascha Friesike: Ja, sie hat das in ihrer Masterarbeit ein „Paradox der entfremdeten Identität“ genannt. Sie sind sehr viel damit beschäftigt, rauszukriegen, wer sie denn eigentlich sind – beziehungsweise sein sollen. Die Idee für diese „entfremdete Identität“ ist so eine Wir-gegen-die-Mentalität: „Wir sind ja anders als die Mutterorganisation. Denn der Grund dafür, dass es uns gibt, ist ja, dass in der Mutterorganisation irgendetwas nicht funktioniert. Gleichzeitig sind wir aber Teil der Mutterorganisation und müssen deswegen in gewisser Weise ähnlich sein“. Was sie in sehr vielen ihrer Interviews rausgekriegt hat: dass dieses Soul Searching, dieses „Was ist eigentlich die Identität unserer Einheit?“, einen enormen Anteil der Zeit dieser Einheit verbrät. Viele Innovationseinheiten werden ja gegründet mit so einer Art Start-up-Idee. Ein Start-up ist aber nicht ständig damit beschäftigt, rauszukriegen: Was sind wir denn eigentlich? Aber in diesen Innovationseinheiten, die ja auch ein bisschen wie ein Start-up sind – aber sie haben nur einen einzigen Kunden, nämlich die Organisation, die sie ins Leben gerufen hat – ist das nicht so einfach zu sagen, wer die eigentlich sind. Die Leute haben auch ganz oft ein ganz anderes Bild davon, was sie denn da erleben werden – als das, was dann passiert. Und das wiederum befeuert dann, dass man sich damit auseinandersetzt: Was ist eigentlich unsere Identität?
Dennis Horn: Löst man das auf, indem man sie einmal von Beginn an festlegt? Also Purpose, Vision, diese Dinge?
Sascha Friesike: Das ist vielleicht ganz gut, dass wir da kurz drüber sprechen: Nur, weil viele Innovationseinheiten und gerade diese Innovation Labs und Hubs scheitern, heißt es ja nicht, dass die grundsätzlich scheitern müssen. Eins der wirklich wesentlichen Elemente dafür, wann es funktioniert, ist, dass sie eine Rolle haben, die für die Mutterorganisation wirklich Probleme löst, also wo eine Anschlussstelle ist und man sieht, was die da machen, wird dort auch weiter verwendet. Dazu kommen wir gleich noch in den anderen Dimensionen dieser Paradoxa. Ich gebe dir mal einen Extremfall, wo es überhaupt nicht funktioniert: „Seid mal verrückt, habt mal ganz wilde Ideen, und dann zeigt uns die!“ Dann gucken da irgendwelche gestandenen Managerinnen und Manager drauf und sagen: „Ja, das ist jetzt wirklich eine verrückte Idee, so richtig können wir da nichts mit anfangen. Macht mal eine andere verrückte Idee.“ Da kommt natürlich direkt wieder Öl in dieses Feuer, dass man sagt: Wer sind wir denn eigentlich? Was ist unsere Aufgabe, wenn der Auftrag ist, verrückte Ideen zu machen, wir mit verrückten Ideen kommen, und dann heißt es, das ist schon ein bisschen verrückt – ihr wisst schon, wer eure Mutterorganisation ist, oder?
Dennis Horn: Punkt Nummer zwei: Innovationseinheiten sprechen gerne in Metaphern über sich selbst. Und die Lieblingsmetapher – das ist mir tatsächlich auch aufgefallen – ist immer die des Schnellboots.
Sascha Friesike: Ja, die des Schnellboots und des Tankers. Es müssen immer zwei zusammen sein, was auch ganz spannend ist, weil dieses Schnellboot ja scheinbar den Tanker manövrieren soll. Und schon in dieser Metapher ist irgendetwas falsch, denn mit dem Schnellboot könnte ich schnell wegfahren – genau das soll ja diese Einheit aber nicht machen. Sie soll ja einen Einfluss haben auf den großen Tanker.
Dennis Horn: Da bekomme ich manchmal die Antwort: „Na ja, das Schnellboot fährt im Nebel vorweg und sucht den Weg.“
Sascha Friesike: Da wird die Metapher schnell komplex, um im Bild zu bleiben. Und dann brauchen wir noch einen Leuchtturm und einen Schlepper und so weiter … und dann bauen wir weitere Einheiten. Sie nennt es in ihrer Arbeit „kontrollierte Flexibilität“: Die Einheit soll eigentlich genau das lösen, was die Mutterorganisation nicht kann – diese soll es dann aber annehmen. Am Anfang dieser Innovation Labs, dieser Innovation Hubs stehen immer die gleichen Probleme. Das sind Organisationen, die im Laufe der Zeit einen viel zu ausgeprägten Grad an Formalität entwickelt haben. Gleichzeitig merken sie, dass es im Umfeld ihrer Organisation total viel Veränderung gibt. Jetzt bin ich absichtlich ein bisschen abstrakt, denn das kannst du auf die Automobilindustrie werfen, das kannst du auf die Medienindustrie werfen. Das kannst du aber genauso auf den Maschinenbau werfen. Es ist immer ein typisches Thema: Digitalisierung – da draußen passiert total viel. Unsere Strukturen in der Organisation sind aber überhaupt nicht dafür da, schnell und flexibel zu reagieren. Also haben wir das Gefühl, da läuft irgendetwas an uns vorbei. Jetzt hat man aber einen Mangel an Veränderungskraft in der Organisation selbst. Die steht nicht mit dem Rücken zur Wand und sagt, ihr müsst euch jetzt neu erfinden. Das kann die nicht. Dafür hat sie zu viel Pfadabhängigkeit, dafür hat sie zu viel Historie, dafür sind zu viele Strukturen gewachsen. Man kann nicht einfach sagen: Wie würde denn – in deinem Fall ein Medienhaus – aussehen, wenn wir es heute gründen? Das können wir malen, aber wir haben keine Möglichkeit, das in die Pfadabhängigkeit eines sehr etablierten Ladens reinzukriegen. Die Beharrungskräfte sind dafür viel zu groß. Dann sagt man aber, wir müssen trotzdem irgendetwas tun. Und gründet dafür eine Einheit. Während das Problem in sich nicht gelöst werden kann, weil ja die Veränderung eigentlich auf die Organisation wirken müsste. Und dann kommen für mich in zwei Abstufungen. Eins sind Innovationseinheiten, die tatsächlich am Produkt schrauben. Beispiel Automobilindustrie: Wir haben immer Verbrenner gebaut, jetzt kommt Elektro. Also brauchen wir eine eigene Einheit, die sich darum kümmert. Wenn wir die mit unseren Verbrennern zusammenpacken, werden die das nicht überleben. Sie muss die Freiheiten haben, quasi die Autos der Zukunft für uns zu machen. Und die zweite Abstufung dieser Innovation Hubs ist, wenn diese Vorschläge über den organisationellen Wandel selbst machen sollen. Das heißt, die arbeiten gar nicht mehr einem Produkt, sondern an Arbeitsweisen. Die sollen quasi Vorschläge dafür machen, wie die viel zu formelle Mutterorganisation in Zukunft bestimmte Prozesse strukturieren könnte. Das ist dann ein merkwürdiges Hybrid zwischen einer Innovationseinheit, die eigentlich Leute anzieht, die gerne kreative, innovative Sachen machen möchten, und eigentlich einer Art Inhouse-Beratung, die aber diesen Beratungsteil gar nicht so sehr machen will wie den Entwicklungsteil.
Dennis Horn: Punkt Nummer drei nennt ihr „wirksame Distanz“. Es ist wichtig, mit einer Innovationseinheit nicht zu tief in diesen Abläufen zu stecken, im „Muff“ des Hauses. Aber was ist die richtige Distanz?
Sascha Friesike: Deswegen ja Paradoxa, weil es nicht auflösbar ist, es ist ein Widerspruch. Und der Widerspruch dieser wirksamen Distanz ist: Unabhängigkeit ist total wichtig. Die Organisation hat ja ein derartig hohes Level an Formalität, dass die Flexibilität, die wir für Innovation brauchen, nicht möglich ist. Das heißt, wir müssen eine unabhängige Einheit schaffen. In dem Augenblick, in dem wir das tun und diese Unabhängigkeit schaffen, verlieren wir aber den Kontakt zu der Mutterorganisation, die ja am Ende die Innovationen kaufen muss, weil das unser einziger Kunde ist. Das heißt: Je wirksamer diese Distanz wird, je weiter ich rausgehe, desto schwieriger wird es für mich, das Zeug dann wieder in die Organisation reinzukriegen. An dem Punkt ist vielleicht ganz wichtig, dass wir einmal darüber sprechen, was Innovation eigentlich ist. Wenn man sich einfach mal ein Lehrbuch nimmt und nachliest, was eine Definition von Innovation ist, ist die eigentlich zweiteilig definiert: Einmal geht es darum, etwas Neues zu schaffen. Und dann geht es darum, dass sich das am Markt auch durchsetzt. Jetzt haben diese Innovationseinheiten überhaupt keinen Markt zur Verfügung, weil die in aller Regel nicht selber rausgehen dürfen. Sondern sie haben eine Monopsonie. So nennen Ökonomen das, wenn es einen Markt gibt, auf dem es nur einen einzigen Kunden gibt, nämlich die Mutterorganisation. Das heißt, sie sind auf Gedeih und Verderb ausgeliefert, der Mutterorganisation die eigene Innovation zu pitchen und die davon zu überzeugen. Typische Zitate, die man dann findet, sind solche wie: „Wir sind überhaupt nicht mehr integrierbar in die Mutterorganisation. Was hier abläuft, ist etwas komplett anderes.“ Das ist immer ein fantastisches Zeichen dafür, dass sie große Schwierigkeiten haben werden, die Sachen dann der Mutterorganisation wieder zu verkaufen.
Dennis Horn: Und gleichzeitig braucht es für die Freiheit – das hast du ja gerade so formuliert – natürlich auch einen gewissen Abstand zur Mutterorganisation, richtig?
Sascha Friesike: Das ist ja der Ausgangspunkt gewesen, weshalb man gesagt hat: Wir brauchen diese Einheit, denn wir kriegen es ja selber nicht mehr hin. Wir haben ein derartiges Level an Formalität erreicht, dass die Idee von innovativen Prozessen, von Neuerungen so schwierig ist und so viel Gremienarbeit braucht, dass wir jemanden brauchen – außerhalb -, der etwas Distanz zu uns hat, um sich überhaupt damit beschäftigen zu können. Und in dem Augenblick, in dem man das schafft, schafft man gleichzeitig die Schwierigkeit, das wieder reinzuholen. Dieser Verlust an Kontakt ist das, worüber in diesen Innovationseinheiten total ungern gesprochen wird. Wenn wir nämlich Innovationen zweiteilig definieren – einmal die Entwicklung von Neuem und dann die Durchsetzung am Markt – und wenn ich nur einen einzigen Kunden habe, dann ist diese Durchsetzung am Markt ein unglaublich aufwendiger, ein politischer Prozess, der das Bohren von dicken Brettern verlangt. Das heißt, ich muss eigentlich sehr viel Lobbyarbeit machen in meiner total formellen Organisation, damit die tollen Ideen, die da entstanden sind, tatsächlich fliegen können. Das ist aber typischerweise nicht das, was die Leute machen wollen, die bei so einer Innovationseinheit andocken, sondern die sagen: Diese Entwicklung von neuen Ideen und hier mal was zu machen, was wirklich anders ist – da habe ich Lust zu. Und dann hat man quasi eine Truppe an Kreativen und bräuchte eigentlich eine halb so große Truppe an Kreativen und eine genauso große Truppe an Lobbyisten, die das dann wieder in diese formelle Organisation zurücktragen. So sind die aber relativ selten aufgebaut.
Dennis Horn: Da sind wir bei einem spannenden Punkt, der uns eigentlich auch schon zu Paradox Nummer vier bringt, nämlich das der folgenlosen Mission. Innovationseinheiten haben einen Auftraggeber, der diesen Auftrag aber gleichzeitig verhindert. Du hast gerade den Punkt der Politik genannt. Das wäre eigentlich der, der das auflösen würde, oder? Man muss dann lobbyieren, um das wieder unterzubringen.
Sascha Friesike: Genau, und das ist ein total aufwendiges Geschäft. Es geht genau darum, dass man sagt: „Hey, entwickelt doch mal radikal innovative Arbeitsmethoden für unsere Organisation.“ Und in dem Augenblick, in dem die dann vorgestellt werden, sagt man: „Also, das ist jetzt ein bisschen radikal und innovativ für uns.“ Und das führt natürlich im Schluss wieder zu dieser entfremdeten Identität, dass sich Innovationseinheiten fragen: Was machen wir denn hier eigentlich, wenn wir monatelang an diesen Ideen werkeln und die dann von demjenigen, der uns den Auftrag gegeben hat – nämlich der Mutterorganisation – verhindert werden. Genau da setzt der politische Prozess ein. Man muss verstehen – gerade, wenn wir über Innovationseinheiten reden, die Vorschläge für organisationellen Wandel machen -, dass die Wandlungsfähigkeit der Organisation, die innoviert werden soll, in aller Regel überschaubar ist. Das war ja der Grund dafür, dass jemand überhaupt diese Einheit gegründet hat. Die Radikalität, die da gefordert wird, ist ganz oft eher kontraproduktiv. Man muss sich das eher vorstellen wie eine Art Zinseszins-Spiel, das durch kleine Veränderungen über Zeit vielleicht etwas bewegen kann, weil der große Mutterkonzern eine derartige Pfadabhängigkeit in der Kultur hat: „Das haben wir schon immer so gemacht.“ „So funktionieren hier die Hierarchiestufen.“ „So sind hier die Gremien.“ „So werden hier die Entscheidungen getroffen.“ Und so weiter. Da müsste ich unglaublich viel Macht zusammenziehen, um da einfach einen Stock in die Speichen reinziehen und von heute auf morgen die Arbeitsprozesse ändern zu können. Das passiert eigentlich nur dann, wenn eine Organisation wirklich volle Kanne mit dem Rücken zur Wand steht.
Dennis Horn: Das heißt, der Faktor der Hauspolitik wird beim Thema Innovation unterschätzt?
Sascha Friesike: Total! Und noch spannender ist: Es gibt durchaus Innovation Hubs, die das voll mitdenken und sagen: Wir müssen hier Leute reinstecken, die von draußen kommen, die eine Nähe zur Start-up-Welt haben, die diese neuen Arbeitsprozesse und Ideen reinbringen, damit wir uns kulturell erweitern können. Und wir müssen Leute haben, die die Organisation sehr gut kennen, damit man intern Überzeugungsarbeit leisten kann. Ich kenne einen Fall, da hat uns der Leiter dieses Hubs oder Labs erklärt: Das haben sie am Anfang auch so gemacht. Und ihr großes Problem war dann, dass all die Leute, die sie für die Lobbyarbeit eingestellt haben, irgendwann gegangen sind. Und zwar nicht wieder zur Hauptorganisation, zum Mutterschiff, sondern irgendwo raus. Die bekommen in diesem Innovation Hub mit: Was könnte man denn noch alles tun? Was gibt es für andere Methoden? Wie wird eigentlich anderswo gearbeitet? Die haben dann Lunte gerochen, haben Blut geleckt und gesagt: Eigentlich will ich nicht zurück in dieses Mutterschiff. Ich glaube, ich mache mal einen anderen Job. Ich traue mich etwas anderes und gucke mal, wie das woanders aussieht. Das ist auch wieder ein total schwieriges Thema, dass diese Lobbyarbeit auch ein echter Knochenjob ist. Und wenn man die ganze Zeit mit coolen Firmen zu tun hat und sieht, was draußen noch so alles passiert, und diese ganzen Innovationen und Prozesse in der Hand hat, kann es durchaus passieren, dass man irgendwann sagt: Ich habe hier spannende Leute kennengelernt, eigentlich wäre das auch eine reizvolle Herausforderung. Ich gucke mal, ob ich mich nicht irgendwie mal da hin bewegen könnte.
Dennis Horn: Ich finde diese vier Paradoxa ganz schön relatable für vieles, was ich in der Medienlandschaft mitbekomme – und kann mir auch vorstellen, dass die Eine oder der Andere, die das jetzt hören, sich ertappt oder beobachtet fühlen. Wenn ich jetzt den Eindruck habe, dass meine Einheit nur geschaffen wurde, um Innovationstheater zu spielen: Welche Möglichkeiten habe ich dann, mich trotzdem wirksam zu machen? Oder sagst du dann: Runter vom Schnellboot?
Sascha Friesike: Ich glaube, in Medienhäusern gibt es dann so eine Art Flucht in die Preise. Dann macht man irgendetwas, das einen Grimme Award gewinnt, und dann hat es eine Art Wertschätzung erfahren. Deshalb ist auch immer eine individuelle Frage: Was ist eigentlich die Motivation? Warum tue ich das? Die Leute ziehen ihre Anerkennung ja aus unterschiedlichen Dingen. Es gibt durchaus Leute, die Anerkennung aus dem Gefühl ziehen, mit einem spannenden Team zu arbeiten und Spaß zu haben. Und es gibt andere, die eine Art externe Anerkennung auch in der Umsetzung brauchen. Ich glaube, das ist ganz oft eine Mogelpackung, dass suggeriert wird, dass man große Innovationen macht – während Innovation eigentlich ein viel, viel längerer Prozess ist. Man spricht im Innovationsmanagement vom fuzzy front end, also diesem unklaren Moment am Anfang: Wir haben ein Problem. Wir haben eine Idee, wie die Lösung aussehen könnte. Aber der Rest des Prozesses wird relativ selten durchlaufen. Man spricht dann nicht mehr von Prototypen, sondern von einem MVP, der gebaut wird. Und der wird dann gern irgendwo ins Regal gestellt, um zu zeigen: In die Richtung haben wir auch was gemacht. Das ist tatsächlich eine Herausforderung für die Motivation. Wohin die Leute dann fliehen, hängt ganz oft von den Spezifika der Organisation ab, also ob sie so eine Art Beiboot – um im Bild zu bleiben – für sich finden, bei dem sie das Gefühl haben: Da kann ich wenigstens ein bisschen was basteln, da mache ich etwas, was mich interessiert und bei Laune hält.
Dennis Horn: Welche Rolle spielt eigentlich die Kommunikation? Also zum Beispiel die Übersetzung von dem, wie Innovationsteams sprechen, die in „Sprints“ arbeiten, „Design Thinking“ nutzen, „Scrum Master“ haben, „agile“ in der „Review“ über „Synthetic Media“ diskutieren.
Sascha Friesike: (überlegt) Ja … Sprache ist ja auch immer ein Mittel zur Ausgrenzung. Deswegen habe ich gerade diesen Begriff eines MVPs genutzt. Das ist halt ein Prototyp. Aber es gibt ein neues Wort dafür, und wenn ich dieses neue Wort verwende, kann ich signalisieren, dass ich diese Sprache spreche. Sie ist Teil der Identifikation, und die Abgrenzung über die Sprache … das ist mit Fachbegriffen sonst ja auch überall so. Wenn man zu seiner Ärztin geht, wirft die einem drei lateinische Begriffe an den Kopf, und man versteht überhaupt nichts. Dann schlägt man das nach, und es stellt sich heraus, das heißt: Kopfschmerzen. Aber die Abgrenzung passiert über die Sprache. Man hat eine Art Hoheitswissen, und dieses Hoheitswissen ist in diesem Fall das Innovationssprech. Wenn ich runterbrechen würde, dass die Sachen, die dahinter stehen, oft gar keine derartige Kunst sind, sondern bestimmte Begriffe, die man auch anders ausdrücken könnte, dann wäre das ein Eingeständnis dafür, dass das, was ich da mache, vielleicht gar nicht so ein Hexenwerk ist. Aber ich glaube, diese Identifikation, die individuelle Identifikation über die Sprache, dient auch ganz oft zur Abgrenzung der eigenen Identität: Wir haben hier eine gemeinsame Sprache. Wir haben einen gemeinsamen Jargon, und die da drüben im Mutterschiff, die verstehen ja gar nicht, was ein Sprint ist.
Dennis Horn: Wenn ich mal etwas handwerklicher werde und auf Innovation im Alltag gucke, dann sehe ich neben der Kommunikation auch an anderen Stellen eine gewisse Fahrlässigkeit. Nummer eins wäre, worüber wir gerade auch schon in Ansätzen gesprochen haben, nämlich dass es selten ein professionalisiertes Innovationsmanagement gibt. In vielen Redaktionen ist es eher das Prinzip Zufall. Es hängt also stark davon ab, ob in einer einzelnen Redaktion Menschen arbeiten, die Kreativität, Ahnung und auch Strategiedenken zusammenbringen – und die es dann sind, die eine digitale Produktidee haben, für einen Podcast, für ein Onlineprojekt, ein digitales Produkt – was auch immer. Wie gehe ich das sortierter an? Wie bringe ich mein Haus auf die Idee, einen Prozess zu starten, den man auch gestalten kann, wenn es um Innovationen geht?
Sascha Friesike: Da bringt du so ein paar Themen zusammen, die wir glaube ich ein bisschen auseinander ziehen müssen.
Dennis Horn: Ja, mach mal. Gerne.
Sascha Friesike: Einmal würde ich die Prozesse nennen. Es gibt so eine Art standardisierte Prozesse. Meistens ist das ein Management-Guru-Term gerade, der die Runde macht und den dann alle benutzen, wie „agil“ oder „Sprint“ oder „Design Thinking“. Das sind eigentlich nichts anderes als Angebote. Diese Prozesse selber leisten erst mal noch nichts, außer dass irgendetwas am Ende rauskommt. Wir haben aber keine Qualitätskontrolle, sondern wenn ich irgendwie „sprinte“, ist am Ende was da – das aber nicht zwangsläufig wirklich die Lösung ist. Wenn man sonst mit Kreativen spricht, folgen die ja nicht einfach einem vorgegebenen Prozess, sondern sie haben sich unterschiedliche Prozesse, die sie gelernt haben, im Laufe der Zeit zu eigen gemacht, sie haben sich überlegt: Was bedeutet das denn in meinem Kontext? Diese Kontextualisierung ist ein Aspekt von dem, was du mit der Professionalisierung eines Innovationsmanagements meinst. „Design Thinking“ oder ein „Sprint“ ist nicht per se gut oder schlecht. Es ist nicht kontextualisiert auf die Fragestellung, die eine bestimmte Organisation hat. Man muss diese Klaviatur lernen. Und das hat auch nicht gerade gestern erst angefangen, sondern da gibt es seit Anfang der 80er durchgängig Literatur, die sich damit auseinandersetzt: Wie wird eigentlich Innovation gemanagt? Und dann muss man überlegen: Was bedeutet das in unserem Kontext für das, was wir hier machen? Ein ganz typisches Beispiel: In unterschiedlichen Industrien sind die Entwicklungszyklen total unterschiedlich, also die Frage, wie lange es von der Idee bis zur Marktreife dauert. Wenn ich eine App entwickle, dauert das deutlich weniger lange, als wenn ich Flugzeuge baue. Entsprechend müssen diese Prozesse angepasst werden. Das Zweite neben den Prozessen: Die Aufgabe, Innovation zu machen, ist keine Aufgabe, die ich auslagern kann an eine Einheit, sondern eigentlich eine der Kernaufgaben einer Organisation – und zwar sowohl, was Produkte angeht, als auch die eigene Arbeit zu hinterfragen. Wenn ich bei Leuten zum Essen eingeladen bin und es gibt Schnitzel, und dieses Schnitzel ist furchtbar, dann sage ich: Die können vielleicht noch kein Schnitzel kochen. Dann bin ich drei Jahre später wieder zum Essen eingeladen, und das Schnitzel schmeckt immer noch furchtbar. Dann scheint der Wille zu fehlen, sich damit auseinandersetzen. Was können wir hier verbessern? Genau das ist Innovation in einer Organisation. Prozessinnovationen nennt man das üblicherweise, was die Abläufe in der Organisation angeht. Das ist eigentlich eine Aufgabe der Organisation selber, sich damit auseinanderzusetzen. Wenn ich die lediglich auslagere und sage, das macht ein kleines Team für mich, dann ist das in sich schon schwierig, weil dieses Team gar nicht den Überblick haben kann, was das denn in allen möglichen Aspekten bedeutet. Und vielleicht noch eine Fußnote dazu: Das hat noch ein weiteres, größeres Problem. Wenn ich Innovation nicht als Aufgabe der Organisation betrachte, sondern eine Extraeinheit dafür schaffe, dann sage ich implizit auch allen anderen Mitarbeitenden: Das ist gar nicht eure Aufgabe. Ihr müsst hier nicht innovativ sein, da haben wir extra ein Team für gegründet. Das heißt, die sind eher demotiviert, sich selbst mit innovativen Themen auseinanderzusetzen und genau diese Professionalisierung voranzutreiben. Die sagen dann: Warum sollte ich mich denn mit Innovationstheorien auseinandersetzen? Wir haben doch extra ein Team für Innovation. Und sagen wir mal, dieses Team scheitert, man streicht diese Innovationseinheit irgendwann und sagt, das hat nicht funktioniert. Dann hat man das Thema komplett aus der Gleichung der Organisation gestrichen.
Dennis Horn: Das heißt, im Idealfall bediene ich beides? Ich schaffe ein Team, das aber auch die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motiviert. Wäre das die Lösung?
Sascha Friesike: Es gibt nicht die Lösung. Wenn es die Lösung geben würde, hätten wir nicht so viele Schwierigkeiten damit. Sondern es ist immer abhängig vom Kontext der Organisation, von der Vorgeschichte, woran man eigentlich arbeitet und so weiter. Aber die Idee, die da drinsteckt, ist sicher gar nicht schlecht: eine Art Hilfe zur Selbsthilfe. Wenn wir Innovation als eine Aufgabe der Organisation selbst begreifen, kann die Organisation das nicht von heute auf morgen, sondern sie muss sich im Laufe der Zeit professionalisieren. Eine Einheit zu haben, die bei dieser Professionalisierung hilft … Es kommt dann auch wieder darauf an: Werden die angenommen? Werden die ernst genommen? Sind die dann nicht demotiviert von dem, was sie in bestimmten Aspekten ihrer Organisation verfinden? Wie weit weg sind die von dem, wie sie sich Innovationen vorstellen? Aber das ist ja grundsätzlich ganz oft die Idee von Innovationseinheiten, die den organisationalen Wandel entwickeln sollen. Nur ist da meist ein derartiger Disconnect, zu dem wie der Alltag im Mutterschiff aussieht – zu langen Sitzungen; und es wird so gemacht, wie es schon vor 20 Jahren gemacht wurde; und dem, was die sich an Methoden vorstellen könnten, wie man auf einem weißen Blatt Papier eine Organisation skizzieren würde -, dass dieses Zusammenstecken nicht so richtig funktioniert. Im Grunde triffst du da schon einen sehr guten Punkt. Ich müsste eigentlich der Organisation im Laufe der Zeit in einer Art Change-Management-Prozess langsam, aber stetig beibringen, sich um all die Probleme aus der Organisation heraus zu kümmern, die man adressieren müsste, um sich weiterzuentwickeln. Dann ist halt die Frage: Habe ich dafür eigentlich die Leute, die weitsichtig genug sind? Oder habe ich eher einen gewaltigen Verwaltungsapparat aufgebaut, der darauf wartet, dass ich ihm genau sage, was er zu verwalten hat?
Dennis Horn: Du hast eben die Sprache als ein Distinktionsmerkmal beschrieben. Ich frage mich manchmal: Welche Rolle spielen Arroganz und Ignoranz gegenüber gegenüber den Realitäten eines Medienhauses? Manchmal wirken Innovationsmenschen auf mich, als hätten sie die Weisheit mit Löffeln gefressen, weil sie ja – und das kann ja auch durchaus sein – wissen, wohin es geht, weil sie sehr weit an der Front der digitalen Entwicklung sind, sich tief mit diesem Thema beschäftigen. Und dann bewegt sich der große Tanker aber nicht in diese Richtung. Und Innovationsteams verhalten sich dann mitunter so, dass sie oft auch das abwerten, was schon da ist. Was ist eigentlich das richtige Verhalten, also die richtige Haltung für Innovationsmanagement?
Sascha Friesike: Das ist eine superspannende Frage, auf die man auch wieder in unterschiedlichen Richtungen gucken kann. Einmal wird der Begriff der Innovation ja auch total übernutzt. Nur weil etwas neu ist, ist es ja nicht zwangsläufig besser. Eigentlich sollte eine Organisation ja etwas machen, was gut ist – und nicht etwas, was neu ist. Das Einzige, was neu sein muss, ist der Inhalt der Tageszeitung. Aber deswegen muss ich ja nicht ständig das Format ändern. Es gibt da ein ganz spannendes Buch, das heißt „Innovation Delusion“, und das beschreibt: Was sind eigentlich die Sachen, die wir ständig übersehen, weil wir so viel über Innovation reden …
Dennis Horn: … und die wir dann nicht reparieren, oder?
Sascha Friesike: Genau. Infrastrukturthemen, typisches Beispiel. Darum müssen wir uns einfach kümmern. Die sind einfach da, bis sie kaputt sind. Dann fällt es uns auf, aber ist nicht so richtig sexy. Innovation ist dagegen einfach: Wir machen hier den neuen heißen Scheiß. Das Zweite, was du ansprichst: die Arroganz. Es gibt tatsächlich ganz spannende Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen Innovativität und … du nennst es Arroganz, in der Psychologie würde man das overconfidence bias nennen. Also: sich selbst zu überschätzen. Ganz typisches Beispiel: Zeig mir mal einen Autofahrer, eine Autofahrerin, die sagt, dass sie unterdurchschnittlich gut fährt. Jeder geht immer davon aus, dass er besser ist als der Durchschnitt. Ganz geile Statistik: 94 Prozent aller Universitätsprofessoren gehen davon aus, dass sie überdurchschnittlich gut in der Lehre sind. Das ist ein typisches Beispiel von overconfidence bias. Und der hat eigentlich zwei Seiten: auf der einen Seite diese tatsächliche Arroganz der Überschätzung; auf der anderen Seite sorgt das dafür, dass man sich überhaupt darauf einlässt. Überspitzt gesagt: Wenn deine arroganten Innovationsleute realistisch einschätzen würden, wie gut ihre Chancen sind, tatsächlich Innovationen in diese Organisation reinzutragen, würden sie wahrscheinlich einen anderen Job machen. Aber sie haben diesen overconfidence bias, diese Arroganz, dass sie davon ausgehen: Ich kann hier wirklich selbst was bewegen. Ich habe ja die Zukunft gesehen. Dass sie sich überhaupt darauf einlassen, ist eine ganz spannende Zweiseitigkeit. Und das Letzte, was du ansprichst, stimmt natürlich auch: dass bestimmte Entwicklungen in der Digitalisierung für Leute, die sich damit beschäftigen, nicht wahnsinnig überraschend sind. Ich war vor zehn Jahren auf irgendeinem Panel, auf dem es darum ging, ob Fernsehen nicht in Zukunft auch übers Netz kommen könnte. Da hieß es: Das wird niemals passieren, die Bandbreite hat man nicht. Mir fiel die Kinnlade runter, mir fehlten die Worte. Dann habe ich gesagt: „Da könnte man ja vielleicht dran schrauben und das in Zukunft verändern.“ Aber nee, da war irgendjemand aus einem großen Sender, der sagte, das kann gar nicht passieren, die Bandbreite ist nicht da. Da kann ich schon verstehen, dass sich dann eine gewisse Ignoranz einstellt.
Dennis Horn: Der overconfidence bias ist etwas, in dem ich mich auch wiederfinde, wenn ich mich mal rückblickend über die vergangenen 20 Jahre beobachte, die ich in diesem Job arbeite. Ich war immer der, der versucht hat, die Dinge nach vorne zu bringen, und da entsteht schnell Frust. Innovationseinheiten drängeln ja auch oft, und dann ist die Gefahr da, zu resignieren. Ist am Ende alles auch eine Frage des Erwartungsmanagements? Also mir selbst klarzumachen, wo sich vielleicht auch die Grenzen für Innovation befinden?
Sascha Friesike: Ich will nicht sagen, dass es nur eine Frage von Erwartungsmanagement ist. Aber ein tatsächliches Problem ist, dass die Erwartungen ganz oft nicht der Realität entsprechen. Dass man Leute einstellt und ihnen das Gefühl gibt: Hier könnt ihr wirklich etwas bewegen. Und dann sind sie irgendwann frustriert und in einer Art innerer Kündigung – so nennen Psychologen das glaube ich, wenn man körperlich noch anwesend ist, aber die Sache nicht mehr so richtig nach vorne bringt. Das kann natürlich passieren, wenn an diesem Erwartungsmanagement nicht wirklich gearbeitet wurde. Gleichzeitig ist es natürlich in gewisser Weise auch eine Aufgabe so einer Einheit, die Grenze dieses Erwartungsmanagements ein wenig zu verschieben. Man möchte ja, dass in der Organisation in Zukunft etwas anderes passiert, etwas anders gemacht wird. Das ist wahrscheinlich ein Henne-Ei-Problem: Wenn ich den Leuten offen sagen würde, worauf sie sich einlassen, wären sie schon in dem Augenblick demotiviert, in dem sie anfangen. Das heißt, ich muss ein bisschen flunkern, wie toll alles möglich ist. Und kaufe mir damit eine gewisse Frustration ein, weil die Leute nicht das bekommen, was man ihnen am Anfang vorgeflunkert hat.
Dennis Horn: Gilt das auch für die Innovation selbst? Meine Wahrnehmung ist: Die Bilder, die sich dann manchmal aufmachen, das sind die aus dem Silicon Valley, da denke ich an Steve Jobs, ans iPhone, aber nicht an den Mittelständler vom Starnberger See, der Innovationen in kleineren Schritten schafft.
Sascha Friesike: Der Mittelständler vom Starnberger See … interessante Postleitzahl für einen Mittelständler. (lacht)
Dennis Horn: Ich musste an ein KI-Start-up denken, das tatsächlich dort sitzt und zum Beispiel Emotionen in Stimmen feststellbar macht.
Sascha Friesike: Sehr gut, sehr gut. Aber ich bin mir nicht so sicher. Natürlich hat diese Silicon-Valley-Erzählung in den letzten 20 Jahren total gut funktioniert. Ich glaube aber, die wirklich spannenden Geschichten sind andere. Gerade das Smartphone ist total schwierig, da wird immer gesagt, man müsste mal das nächste Smartphone erfinden. Das ist halt das größte Blockbuster-Produkt, das je entwickelt wurde, wenn man sich anguckt, in welcher Geschwindigkeit das wie viele Leute gekauft haben. Das überschattet vieles. Aber ist ja nicht so, dass keine Innovation passieren würde. Vor Corona war ich in relativ vielen Organisationen unterwegs, habe mir angeguckt, was da passiert – und das ist ja nicht so, dass das nirgendwo funktionieren würde. Ich glaube eher umgekehrt: Dieser Halo-Effekt – also dieses Überscheinen des Silicon Valleys, und dann versuchen wir, es auch so zu machen, ohne diese Kontextualisierung vorzunehmen – ist eigentlich ein viel größeres Problem, als sich darauf einzulassen: Na ja, was können wir denn eigentlich als Organisation? Worin sind wir gut? Es gibt ja nicht umsonst diesen erfolgreichen Mittelständler am Starnberger See und noch viele andere, die trotzdem Dinge gewuppt kriegen. Aber ich glaube, diese Idee „Wir müssen da irgendwie mehr sein wie das Silicon Valley!“ und dann Teile davon zu kopieren und in die eigene Organisation reinzudrücken, ohne dass die da wirklich passen, ist ganz oft auch ein oberflächliches Verständnis davon, warum bestimmte Dinge funktionieren oder nicht. Ich habe selbst ein Jahr während meiner Doktorarbeit im Silicon Valley gearbeitet und hatte danach nicht zwangsläufig das Bedürfnis, zu bleiben. Mein Gefühl war: Viele Sachen sind toll, viele Sachen sind auch furchtbar. Ich glaube, ganz viele dieser Ideen „Wie sieht denn Innovation aus?“ sind fast ikonoklastisch: Man sieht, was passiert, und kopiert dieses Gesehene, weil es das Bild einer Innovation ist, das man im Kopf hat. Typische Beispiele sind Räume mit Industriehallen-Flair, die ein bisschen nach alter Werkstatt aussehen. Da muss eine große Tafel sein, es muss eine – inzwischen fast ironische – Tischtennisplatte rumstehen. Es hat immer was mit Spielzeug zu tun, ständig werden Sachen mit LEGO gebaut. Und das hat oft nur etwas Oberflächliches. Dann sind wir sehr stark beim Begriff deines Podcasts: bei einem Theater, das gespielt wird. Ich war mal bei einem großen deutschen Automobilhersteller. Da gab es ein paar riesengroße CNC-Fräsen im Raum, 3D-Drucker und so weiter. Und dann standen da lauter gestandene Ingenieurinnen und Ingenieure und bastelten mit LEGO. Sie hätten das, was sie basteln sollten, auch auf den Geräten dahinter in echt herstellen können. Aber ihnen wurde gesagt: Macht das doch mal in LEGO.
Dennis Horn: Gunter Dueck nannte das mal Cargo-Kult. Ich glaube, das geht in eine ähnliche Richtung: Du stellst nur die Sitzbälle hin, und der Rest ergibt sich von selbst – was natürlich so nicht funktioniert.
Sascha Friesike: Kennst du die Geschichte davon?
Dennis Horn: Ja. Das ist die der Ureinwohner auf den Inseln, auf denen das US-Militär stationiert war. Das hat diesen Inseln Fortschritt gebracht, die Menschen hatten dann Nahrung, Geld und so weiter – und dann war der Krieg vorbei.
Sascha Friesike: Irgendwann waren die Soldaten weg, und es kamen keine Flugzeuge mehr.
Dennis Horn: Und dann haben die Ureinwohner die Flugzeuge mit Bambusstäben nachgebaut, oder?
Sascha Friesike: Ja, den Tower und das, was am Boden war, weil sie gedacht haben, damit kann man die Götter wieder rufen. Das eigentliche Bild von so einem Cargo-Kult ist, dass es keine Verbindung gibt zwischen dem, was man tut, und dem, was dabei rauskommen soll. Das ist tatsächlich ganz oft bei diesen oberflächlichen Dingen, bei denen man sagt: Das nehmen wir mit, weil es wie Innovation aussieht. Aber ich glaube, da ist noch mehr drin als nur Cargo-Kult. Ein Cargo-Kult geht ja davon aus, dass man daran glaubt, dass es so funktioniert. Ich würde das window dressing nennen. Es geht eigentlich darum, Dinge ins Schaufenster zu stellen, um anderen zu signalisieren: „Wir machen ja Innovation. Seht ihr nicht? So sieht Innovation aus!“ Es geht nicht nur darum, dass wir hoffen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Innovativität des Medienhauses und der Anzahl an Tischtennisplatten oder Kickern. Sondern darum, dass man das auch anderen zeigen kann. Deswegen sind diese Innovation Hubs ganz oft Orte, die man schön zeigen kann, die cool aussehen, die einen Vibe haben: Ah, hier sieht es aus wie bei einem Start-up. Während alles, was wir darüber wissen, in welchen Umgebungen Kreativität funktioniert, total subjektive Umgebungen sind, die Leute selber gestalten und daran arbeiten können. Die also wenig damit zu tun haben, dass sie standardisiert sind. Mein Bruder ist Künstler. Wenn man dem und seinen Künstlerfreunden vorschlagen würde: „Ihr habt jetzt hier ein standardisiert cool aussehendes Atelier, denn so macht man coole Bilder.“ Da würden die sagen: „Ihr habt sie doch nicht alle!? Wir arbeiten alle unterschiedlich, und die Arbeitsumgebung muss dem entsprechen, wie ich arbeiten will, und nicht dem, was gerade cool und hip ist.“ Ich glaube, dafür ist diese Darstellbarkeit „Wir können das zeigen!“ ganz wichtig. Das ist für mich mehr als ein Cargo-Kult. Es geht darum: „Leute, schaut mal hier – Fernsehrat oder so etwas – hier passiert Innovation!“
(Hinweis: Ich habe das Gespräch aus dem Podcast zur besseren Lesbarkeit leicht geglättet.)
Feedback? Kritik? Fragen?
Wenn ihr das Innovationstheater interessant findet und ihm schon folgt: Ihr könnt mir helfen, wenn ihr meinem Podcast in eurer Podcast-App eine ordentliche Bewertung verpasst und einen Kommentar hinterlasst.
Ihr habt Gedanken zum Podcast? Feedback, Kritik, Fragen? Schickt mir gerne eine E-Mail an horn@dennishorn.de, meldet euch in den Kommentaren oder auf welchem Weg auch immer.
Und wenn ihr über den Podcast und Neuigkeiten zum Projekt auf dem Laufenden bleiben möchtet – abonniert jetzt den Newsletter!
Alle Episoden

23 Episoden